Die
Geschichte der Firma Commodore
Was viele (ehemalige)
Anwender der C64- und Amiga-Computerlinien gar nicht wissen: Commodore war in
der schnellebigen und recht jungen Computerbranche ein regelrechter Oldtimer.
Die Anfänge reichen zurück in die Fünfziger Jahre. Und als eine der ersten
großen Firmen ging CBM in Konkurs.
Die
frühen Jahre
Commodore
begann wie viele andere Firmen, die heute große Namen in der
Informationstechnologie darstellen, nicht als Hersteller von EDV-Hardware. Nicht
einmal richtiger Elektronikanbieter war CBM in den Anfangstagen, sondern ähnlich
wie IBM begann man mit der Herstellung von mechanischen Schreibmaschinen.
Jack Tramiel, der spätere Gründer, wurde in Polen geboren. In der Zeit des
Nationalsozialismus überfiel das deutsche Reich Polen und Tramiel wanderte als
Jude in die Konzentrationslager. Er überlebte sechs Jahre Zwangsarbeit und
kehrte seiner Heimat nach der Befreiung den Rücken, um die Zukunft im Land
seiner Retter, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA zu suchen.
Leider waren die Jobs für Einwanderer auch nicht gerade zahlreich und so
entschloß er sich, in der Armee als Berufssoldat zu dienen.
Alles begann, als der junger Söldner im Fort Dix der US Army ein Talent zeigte,
das nicht so recht zu einem Soldaten passen wollte: er konnte alte
Schreibmaschinen schnell und gut reparieren. Die anderen Soldaten bekämpften
die Feinde des Landes, Jack Tramiel kämpfte mit Öl und Schraubenzieher gegen
Staub, verbogene Typenhebel und abgenutzte Buchstaben. Als seine Militärzeit
abgelaufen war, öffnete er eine kleine Werkstatt in der Bronx, New York. Nachts
arbeitete er nebenbei als Taxifahrer. Langsam, aber sicher stieg der Umsatz,
doch Tramiel wollte mehr. Der Visionär und begnadete Geschäftsmann erkannte,
die Zukunft gehörte den elektromechanischen Schreibmaschinen und Addiergeräten.
Mit der Tschechoslowakei vereinbarte er ein Geschäft: Die Montage von
Schreibmaschinen in Kanada. Mit seiner Familie zog er nach Toronto, wo er 1958
die Grundsteine von Commodore International Limited legte.
Einige
Jahre später übernahm er einen alteingesessenen Hersteller mechanischer
Schreibmaschinen und das Imperium war geboren. Den Kundenwünschen folgend, bot
er zusätzlich mechanische Rechenmaschinen erfolgreich an. Eine weitere Übernahme
war die Möbelfirma, deren Produkte er bislang verkaufte. Commodore zog dort ein
und stellte jetzt unter eigenem Namen Büromöbel her, darunter Tische, Schränke
und Aktenvernichter. In dieser Fertigungsstätte werden später die Gehäuse des
PET gefertigt. Anfang der Sechziger wurde CBM der größte Hersteller von Büromöbeln
in Kanada.
1962 war Commodore International erfolgreich genug, um an die Börse zu gehen.
Unter dem Namen "Commodore Business Machines" firmierte Jack Tramiel
als Präsident, Chairman wurde der Präsident der Atlantic Acceptance
Corporation (eine mittlere Privatbank Kanadas), C. Powell Morgan. 1965 wurde
Morgan von einer kanadischen Kommission wegen "Verachtung aller
allgemein anerkannten Wirtschaftsprinzipien" und Handlungen von "raffgierigen
und prinzipienlosen Finanzmanipulationen" öffentlich angeklagt und
verurteilt. Zwar hatte diese Verurteilung keine rechtlichen Konsequenzen, aber
er war bald danach unfähig, einen 5-Millionen-Dollar-Kredit zurückzuzahlen.
Bevor er aber wegen Steuerhinterziehung und betrügerischen Konkurs verurteilt
werden konnte, starb er an Leukämie. Die Kommission begutachtete nun das Verhältnis
von Morgan und Tramiel, die beide Commodore leiteten. Zwar war man von Tramiels
Unschuld an den Affären nicht ganz überzeugt, mangels Beweisen mußte man in
aber in Ruhe lassen. Allerdings schädigten diese öffentlichen Diskussionen den
Ruf Commodores doch erheblich. Die Umsätze gingen zurück, Geld wurde knapp und
der Konkurs von CBM schien nahe.
Eine Wende kam, als sich der Investor Irving Gould für 400.000 Dollar
bereiterklärte, 17% der Aktien zu kaufen, und dafür den Posten des Chairmans
(entspricht etwa dem deutschen Vorsitzenden des Aufsichtsrates einer
Aktiengesellschaft) sowie alle Ansprüche auf hereinkommende Zahlungen zu
erhalten.
Die
Elektronik hält Einzug
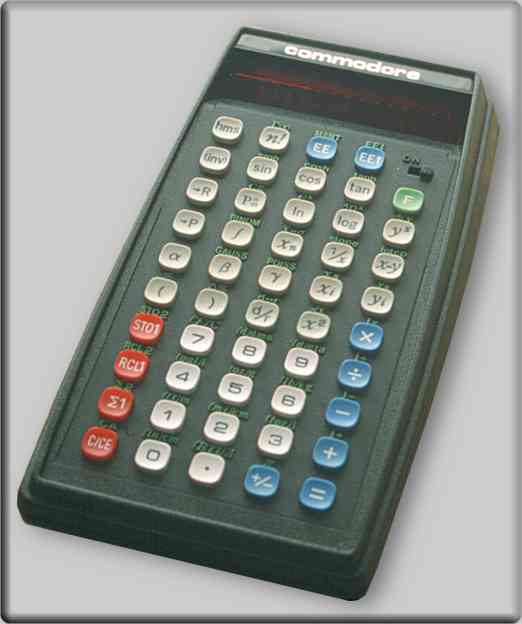 Trotz
allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen
als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den
nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen
Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den
amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern
aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß
das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr
bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969
seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das
Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem
Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst
Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern
(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer
Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als
man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die
vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa
400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.
Trotz
allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen
als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den
nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen
Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den
amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern
aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß
das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr
bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969
seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das
Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem
Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst
Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern
(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer
Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als
man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die
vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa
400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.
Aber bald sollte CBM ein neues Problem bekommen. Texas Instruments wollte mehr
vom Kuchen. Nur die ICs an Commodore verkaufen, das war den Managern von TI zu
wenig. Sie brachten 1975 eine eigene Serie von Rechnern auf den Markt, die halb
so teuer wie die von CBM waren. Die Chips von Texas Instruments kosteten Tramiel
45 Dollar pro Rechner im Einkauf. TI stellte sie für 12 Dollar her. Durch die
große Nachfrage wurden größere Stückzahlen produziert, und die Preise pro
Chip fielen auf 1 Dollar (dieser rasche Preisverfall ist in der EDV-Branche so
üblich. Moores Gesetz sagt aus, alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit
der Hardware bei stetig fallenden Preisen.) Commodore hatte alle Lager voll mit
Rechnern, deren Chips den alten, hohen Preis gekostet hatten. Nach Jahren des
steigenden Profits machte man 1975 einen Verlust von 5 Millionen Dollar, einem
Zehntel des Umsatzes. Tramiel lernte seine Lektion: Niemals von jemandem abhängig
sein. Er sagte später: "Von da an wußte ich, der einzige Weg, im
Geschäft zu bleiben, war, es komplett zu kontrollieren." Das Ende
der Taschenrechnerära
war gekommen.
 Das
war leichter gesagt als getan. Der Markt der Rechner und Halbleiter war
risikoreich und unvorhersagbar. Irving
Gould rettete noch einmal die Firma, indem er insgesamt 3 Millionen Dollar
Risikokapital auftrieb, von denen CBM 1976 unter anderem für 800.000 Dollar die
Chipschmiede MOS Technologie aufkaufte. MosTek war ein Anbieter von
Taschenrechnern und Halbleitern, der zwar genauso in der Krise steckte wie CBM,
aber gemeinsam war man stärker. Es folgten weitere Übernahmen: Frontier, ein
Hersteller von CMOS-Chips in Los Angeles sowie MDSA, die LCD-Displays
produzierten. Die Aufkäufe versorgten CBM mit Know-How in Schlüsseltechnologien
der EDV-Branche, die einen gewaltigen Vorsprung zur Konkurrenz darstellten.
Das
war leichter gesagt als getan. Der Markt der Rechner und Halbleiter war
risikoreich und unvorhersagbar. Irving
Gould rettete noch einmal die Firma, indem er insgesamt 3 Millionen Dollar
Risikokapital auftrieb, von denen CBM 1976 unter anderem für 800.000 Dollar die
Chipschmiede MOS Technologie aufkaufte. MosTek war ein Anbieter von
Taschenrechnern und Halbleitern, der zwar genauso in der Krise steckte wie CBM,
aber gemeinsam war man stärker. Es folgten weitere Übernahmen: Frontier, ein
Hersteller von CMOS-Chips in Los Angeles sowie MDSA, die LCD-Displays
produzierten. Die Aufkäufe versorgten CBM mit Know-How in Schlüsseltechnologien
der EDV-Branche, die einen gewaltigen Vorsprung zur Konkurrenz darstellten.
Um Steuern zu sparen, verlegte Tramiel den Firmensitz aus den USA in das
Steuerparadies Bahamas. Das Hauptquartier zog nach Costa Mesa, Kalifornien um.
Die neue schlanke Organisation war bereit, sich wiedererstarkt neuen Aufgaben
zuzuwenden.
In
den Siebzigern sahen alle Fachleute die Zukunft der EDV in riesigen
Rechenzentren, die über Terminals mit dem Anwender verbunden waren. Firmen wie
IBM, DEC oder Digital konnten sich nicht vorstellen, daß die Leistung eines
Rechenzentrums jemals in einer Kiste auf dem Schreibtisch Platz hätte. Die
Erfindung des Mikroprozessors hatte IBM zwar registriert, baute seine schrankgroßen
Computer aber weiterhin aus Hunderttausenden von Transistoren und ICs. Tramiel
dachte da anders. "Computer für die Masse, nicht für eine besondere
Klasse", das war jetzt sein Leitgedanke.
Zusammen mit MosTek hatte man einen damals noch unbekannten Ingenieur namens
Chuck Peddle eingekauft, der kurz zuvor den Motorola-Prozessor 6800 wesentlich
verbessert hatte. Diese CPU nannte er 6502. Sie kostete im Verkauf nur
einen Bruchteil der Preises, den Intel für seinen 8080 verlangte. So wurde der
6502 auch von anderen Bastlern als Herz von Microcomputern eingesetzt, z. B. von
Steve
Wozniak in seinem Apple I.
Die Legende sagt, daß Peddle eines Tages Tramiel einfach auf dem Flur ansprach.
"Vergessen Sie die Taschenrechner. Der Markt ist tot. Wie wär's mit
einem Desktop-Computer?" - "Bauen Sie einen",
sagte Jack. So wurde der PET
geboren, mit dem MosTek 6502 als Herz. (Peddle wird später nach seiner Kündigung
die Firma Tandon gründen.)
Die Ankündigung, daß CBM einen Computer bauen wollte, stieß auf wenig
Interesse. Damals, Anfang 1976, bestanden die Käufer von Microcomputern aus
Hobbybastlern, die in der Küche mit Lötkolben und einzelnen Chips
herumbastelten, irgendwelche Selbstbaukits zusammensetzten und dann die gesamte
Software selber programmierten. Das war Tramiel egal. "Die Bevölkerung weiß
gar nicht, was sie braucht", so Jack. Der Name war wohl auch wichtig. PET
heißt Haustier und die Buchstaben stehen für Personal Electric Transactor,
etwa persönlicher elektrischer Geschäftsmann. Aber PET steht riesig groß auf
dem Gehäuse, der Rest ganz klein. So nahm man dem Kunden die Angst vor einen
Computer, denn damals waren Computer noch riesige Kisten, die in Rechenzentren
herumstanden, massenhaft Strom fraßen, Unmengen von Luft zum Kühlen
eingeblasen bekamen und mindestens 250.000 Dollar kosteten.
Die
8-Kilobyte-Version wurde zuerst auf der Chicago Consumer Electronics Show (CES,
vergleichbar mit der CeBit heute) gezeigt, die Besucher und Journalisten waren
begeistert. Der erste richtige Personal Computer, bereits fertig montiert, mit
Tastatur und Massenspeicher (Kassettenrecorder), mit BASIC im ROM, zusammen für
nur 800 Dollar, das war 1977 eine Sensation. Obwohl Peddle große
Schwierigkeiten hatte, das Gerät lauffähig zu präsentieren (er mußte mit
einem nicht mal ganz fertigen Prototyp nach Chicago und brauchte 3 ganze Tage
ohne Schlaf, um ihn messefertig zu bekommen), hielt der PET die Messetage durch.
Innerhalb weniger Monate erhielt Commodore bis zu 50 Händleranfragen pro Tag.
Alle wollten den PET vertreiben, alle diese Händler wurden von ihren Kunden gelöchert,
wann der PET endlich in ihrer Stadt erhältlich war. Diese enorme Nachfrage ermöglichte
es Commodore, die Händler auszusortieren. Wer PETs verkaufen wollte, mußte
seinen Finanzen offenlegen, eine hohe Sicherheit hinterlegen, einen
Servicetechniker nachweisen und seine Kunden- bzw. Anfragelisten präsentieren.
Die Verkaufszahlen stiegen langsam in die Tausende (damals waren das riesige Stückzahlen!),
und da erinnerte sich Tramiel an seine Lektion, die ihm Texas Instruments
gelehrt hatte: "Schmeiß den Mittelsmann raus. Warum sich mit Einzelhändlern
herumärgern?" Jack verkaufte nun direkt an große
Handelsketten, und die bestellten gleich Dutzende von PETs auf einmal, statt wie
die kleinen Händler, immer stückweise. Diese kleinen Händler, die so hart um
ihr Recht gekämpft hatten, PETs verkaufen zu dürfen, waren nun fast
ausgebootet.
Mit
dem PET wurde Commodore erstmals eine weltweite Firma. Die mechanischen Geräte
waren nur in den USA und Kanada angeboten worden und die Taschenrechner
verkauften sich auch nur dort gut. Der Computer aber wurde gerade in Europa in
Schulen, Universitäten und von kleinen Geschäftsleuten gut aufgenommen.
Technisch gesehen, war der PET vor seiner Marktreife verkauft worden. Die erste
ausgelieferte Version des Betriebsystem-ROMs enthielt gravierende Fehler. Z. B.
verhinderte ein simpler Tippfehler des Programmierers das Laden abgespeicherter
Programme von der Floppy.
Wer sich die teure Floppy leisten konnte, stellte sofort fest, das er sein
Basicprogramm zwar auf Diskette ablegen konnte, aber die Laderoutine gnadenlos
abstürzte. Auf Anfrage verkaufte CBM bzw. der jeweilige Händler das neue ROM für
teures Geld. Die nach Auslieferung der Floppy 2031 hergestellten PETs bekamen
zwar das neue ROM, aber etliche standen noch bei den Händlern, die wurden nur
auf Kundenanfrage umgerüstet. Diese Verhalten wurde für Commodore und viele
andere Firmen in der Branche üblich. "Nutz den Erstkäufer als Betatester.
Wenn dieser Fehler feststellt, ist er froh, wenn sie beseitigt werden. Da zahlt
er gerne nochmal drauf." In der Autobranche wäre so etwas völlig unmöglich.
Oder bezahlt jemand nochmal, wenn sein Neuwagen nachträglich mit Rückwärtsgang,
Handbremse oder Blinker ausgerüstet wird bzw. die Ölpumpe 3 Monate nach dem
Kauf endlich gegen eine funktionsfähige ausgewechselt wird?
Und so wurde CBM nicht zum Marktführer. Der etwa zum gleichen Zeitpunkt
vorgestellte Apple
II war leistungsfähiger und besser zu erweitern als der PET. Im
Business-Bereich war der Apple II die erste Wahl, den PET kauften Anwender, die
Wert auf ein komplettes System legten (der Apple bestand aus mehreren Teilen:
Monitor, Kassettenrecorder, Rechner; das sorgte für Kabelsalat. Den PET steckt
man in die Netzdose und fertig.) Und die richtigen Freaks, die sowieso lieber
selber am Gerät herumbasteln wollten, kauften den TRS-80
von Tandy, einer Firma, die viele Millionen CB-Funkgeräte unter die
amerikanische Bevölkerung gebracht hatte. Zwar war der Tandy auch nicht
schneller oder besser als der PET, aber die Bastler gingen eben lieber in den
Laden, in dem sie auch Ersatzteile, Erweiterungschips, Rat und Tat bekommen
sowie andere Bastler trafen.
 Nach dem relativen Erfolg des PETs
ruhte sich Commodore nicht auf den Lorbeeren aus. Neue
Rechner wurden entwickelt. Technisch stellten sie zwar nur Verbesserungen
des PET dar (mehr Speicher, größerer Bildschirm, 80 Zeichen/Zeile,
"richtige" schreibmaschinenähnliche Tastatur), aber die CBM 3000-,
4000- und 8000-Serien erhielten jeweils Features, die bei der Vorgängerversion
nicht denkbar bzw. machbar gewesen waren. Ab 1979 kamen diese Geräte auf den
Markt, deren Verkaufspreise aber teilweise erheblich über dem des PET lagen und
den Profibereich anpeilten. Als Homecomputer waren diese Geräte nicht gedacht.
Von 1981 bis 1984 wuchs der Umsatz um das Siebenfache auf 1 Milliarde US-Dollar.
CBM war eine der größten Hersteller der EDV-Branche.
Nach dem relativen Erfolg des PETs
ruhte sich Commodore nicht auf den Lorbeeren aus. Neue
Rechner wurden entwickelt. Technisch stellten sie zwar nur Verbesserungen
des PET dar (mehr Speicher, größerer Bildschirm, 80 Zeichen/Zeile,
"richtige" schreibmaschinenähnliche Tastatur), aber die CBM 3000-,
4000- und 8000-Serien erhielten jeweils Features, die bei der Vorgängerversion
nicht denkbar bzw. machbar gewesen waren. Ab 1979 kamen diese Geräte auf den
Markt, deren Verkaufspreise aber teilweise erheblich über dem des PET lagen und
den Profibereich anpeilten. Als Homecomputer waren diese Geräte nicht gedacht.
Von 1981 bis 1984 wuchs der Umsatz um das Siebenfache auf 1 Milliarde US-Dollar.
CBM war eine der größten Hersteller der EDV-Branche.
unter
anderem wurden erstmals Drucker unter dem Namen CBM verkauft. Zwar handelte es
sich lediglich um OEM-Geräte (d. h., ein anderer Hersteller wie Epson oder
Seikosha baute die Geräte und klebte gleich Commodore als Typenbezeichnung
auf), aber endlich konnte der Anwender komplett auf CBM-Maschinen arbeiten. Der
CBM 8000 speicherte die Daten in einer CBM8050 auf Comodore-Disketten (von
Rhone-Poulenc Systems in Flankreich produziert), der 4022P druckte auf
Commodore-Papieren aus. Dieses OEM-Geschäft wurde später vervollkomnet, so
wurden viele Floppys der Typen 15XX bzw. SFD 1001 direkt in Japan hergestellt,
zum C64
und Amiga
gab es passende Monitore von Thomson oder Philips.
Tramiel
teilte die Entwicklungsabteilung auf: In die professionelle Linie, die in
Braunschweig, Deutschland saß, weil in der BRD der Großteil der Profi-Rechner
verkauft wurde. Und die USA entwickelte Heimcomputer. Diese strikte Trennung
zwischen Low- und Highend hielt man bis 1988 durch und führte zu internen
Rivalitäten, die zwar beide Teams anspornte, besser als das andere zu sein,
aber es wäre wohl besser gewesen, mit vereinten Kräften gegen die Konkurrenz Apple,
Atari,
Tandy usw. anzutreten.
Die Heimcomputer-Abteilung brachte 1981 den VIC-20
auf den Markt. Im Vergleich zu den großen Brüdern der 8000-Serie
ist er ein Rückschritt (eigentlich besteht er nur aus Tastatur mit eingebauter
CPU), doch bei einem Verkaufspreis von 1000 DM kann man nicht mehr als 3,5 KB
RAM, 22 x 23 Zeichen, Ferseheranschluß, externes Netzteil, Cassettenlaufwerk
und langsame Rechengeschwindigkeit erwarten. Immerhin ist er der erste
CBM-Computer, der Farben darstellen und Töne von sich geben konnte. In
Deutschland nannte man ihn nicht VIC-20 (VIC nach dem eingebauten Videochip
Video Interface Controller), sondern VC-20. Ähnlich dem Käfer als Volksauto
der fünfziger und sechziger Jahre wollte man den kleinen Rechner als
Volkscomputer (VC) unter die Bevölkerung bringen.
Der VIC-20 wurde der erste CBM-Rechner mit großen Verkaufszahlen. Bis 1985
wurden weltweit ca. 500.000 Stück vertrieben, darunter 200.000 in der BRD. Bis
zu 9000 Geräte wurden pro Tag hergestellt. Zwar war er nicht der erste
erfolgreiche Homecomputer (das war, aufgrund der Kampfpreises von 300 DM, der
Sinclair ZX 81), aber einer, der viele Anwender für Commodore gewann.
Die
ersten Produkte aus Braunschweig
Die
Fertigungsstätten in der BRD bauten zunächst importierte CBM 4000-Platinen in
Gehäuse ein; es wurde dann groß "Made in Germany" aufgeklebt. Die
neue Entwicklungsabteilung schuf aber bald den CBM 8032 und später den 8032SK,
den ersten Rechner in einem ansprechenden, von den Entwicklern ergonomisch
gedachten, Gehäuse. Erstmals konnte man die Tastatur abnehmen und den
angebauten Monitor drehen und schwenken. Leider war die Tastatur zu hoch, als daß
eine gesunde Schreibhaltung möglich gewesen wäre. Dafür hatte sie erstmals
deutsche Umlaute.
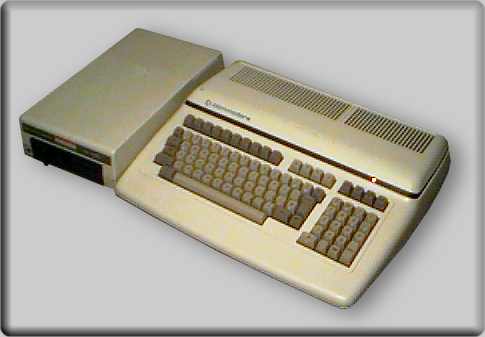 Eine
Forderung der Geschäftsleitung in den USA war ein neuer Heimcomputer. West
Chester, USA entwickelte an etwas, was später der C64 werde sollte. Und in
Braunschweig machte man sich auch an einen Tastatur-Computer (also ein System,
in dem Motherboard und Tastatur in einem flachen Gehäuse untergebracht sind.)
Der 610 wurde
zusammen mit dem 500 (technisch identisch mit 610, nur hat der den
C64-Videochip) und dem 720 (technisch identisch, lediglich mit 256 KB RAM und in
einem Gehäuse mit Monitor und abgesetzter Tastatur) entwickelt. Leider
konzentrierte sich die Konzernleitung auf die Vermarktung des billigeren C64.
Laut Pressestimmen war der 610 dem C64 haushoch überlegen, war jedoch zu teuer
(wegen 128 KB RAM) und erst nach dem C64 zu haben. So folgte der Markt dem neuen
System nicht, obwohl er technisch besser war. Über den Expansionsport waren
Erweiterungskarten, z. B. Centronics, RAM-Ausbau bis maximal 960 KB (per
Bank-Switching, 16 Bänke á 64 KB) möglich. Ein interner Erweiterungsplatz für
Zweitprozessor (Z80/8080/8085) erlaubte CP/M, doppelte Taktgeschwindigkeit (also
fast doppelte Rechenleistung) im Vergleich zum C64, Tastatur mit Ziffernblock,
usw. Durch den riesigen Erfolg des C64 überrollt, wurde der 610 ab 1985 für
wenig Geld verramscht und stellte den ersten Fehlschlag Commodores dar.
Eine
Forderung der Geschäftsleitung in den USA war ein neuer Heimcomputer. West
Chester, USA entwickelte an etwas, was später der C64 werde sollte. Und in
Braunschweig machte man sich auch an einen Tastatur-Computer (also ein System,
in dem Motherboard und Tastatur in einem flachen Gehäuse untergebracht sind.)
Der 610 wurde
zusammen mit dem 500 (technisch identisch mit 610, nur hat der den
C64-Videochip) und dem 720 (technisch identisch, lediglich mit 256 KB RAM und in
einem Gehäuse mit Monitor und abgesetzter Tastatur) entwickelt. Leider
konzentrierte sich die Konzernleitung auf die Vermarktung des billigeren C64.
Laut Pressestimmen war der 610 dem C64 haushoch überlegen, war jedoch zu teuer
(wegen 128 KB RAM) und erst nach dem C64 zu haben. So folgte der Markt dem neuen
System nicht, obwohl er technisch besser war. Über den Expansionsport waren
Erweiterungskarten, z. B. Centronics, RAM-Ausbau bis maximal 960 KB (per
Bank-Switching, 16 Bänke á 64 KB) möglich. Ein interner Erweiterungsplatz für
Zweitprozessor (Z80/8080/8085) erlaubte CP/M, doppelte Taktgeschwindigkeit (also
fast doppelte Rechenleistung) im Vergleich zum C64, Tastatur mit Ziffernblock,
usw. Durch den riesigen Erfolg des C64 überrollt, wurde der 610 ab 1985 für
wenig Geld verramscht und stellte den ersten Fehlschlag Commodores dar.
Als 710 (technisch gleich dem 610, jedoch im Gehäuse des CBM
8032SK), 720 (256 KB) und 730 (zusätzlich mit 8080-Karte für CP/M) sollte
die Linie wieder Boden im Büro zurückerobern. Die c't schrieb damals, daß das
Gehäuse des 710 recht eigenwillig und bestimmt nicht ergonomisch wäre, denn
die Tastatur war zwar vom Rest getrennt, aber völlig sinnloserweise viel zu
dick (die eigentliche Tastatur war recht dünn, nur das Tastaturgehäuse war
klobig geraten), so daß eine natürliche Schreibhaltung unmöglich und längeres
Arbeitern sehr ermüdend sei. Außerdem ist die Anordnung der einzelnen Tasten
recht unlogisch, besonders die wichtigen Cursor-Tasten liegen in einer Reihe
(rauf, runter, links, rechts), da greift man fast immer daneben. Dafür war der
Monitor dreh- und kippbar, für CBM-Rechner vorher völlig undenkbar (sie waren
immer fest mit dem Grundgerät verbunden). Mit Schnittstellen war er gut bestückt:
RS232C, IEE488 (gleich zweimal), Datassette (wurde aber vom Betriebssystem nicht
angesteuert!), User-Port (nur intern), Erweiterungssteckplatz für RAM/ROM -
und: Ein RESET-Taster! Das war ebenfalls noch nie serienmäßig gewesen. Das
eingebaute, stark verbesserte Basic (mit Fehlerbehandlung, DELETE, IF-THEN-ELSE
usw.) war zwar kompatibel zu den Basics der Vorgänger, aber wieder einmal
wurden viele Systemadressen in der Zero-Page und im ROM geändert, so daß
Maschinensprache-Routinen wieder einmal angepaßt werden mußten (das hatte CBM
bisher bei jedem neuen Rechner so gemacht, da erwartete man beim 710 auch nichts
anderes mehr). Der Monitor leuchtete sehr stark nach, dadurch flimmerte das Bild
zwar nicht, aber die Cursorpositionierung geriet zum Glücksspiel (das blinkende
Kästchen verschwindet bei Bewegungen völlig, erst wenn der Cursor etwa 0,5 sek
am selben Platz steht, sieht man ihn wieder).
Resümee der Tester: Für den Anwender kaum zu gebrauchen, da keine alte
Software läuft. Und für Programmierer nur eingeschränkt, da CBM mit
Informationen zu Zero-Page, ROM-Code usw. geizte. Für 3000 DM ein halbwegs
gelungener Rechner, jedoch mit einigen Haken und: er kam zu spät. Angekündigt
bereits 1982, kam er erst 1984 auf den Markt, die Konkurrenz hatte ihn längst
überflügelt. Und trotzdem wurde er ohne deutsche Anleitung ausgeliefert (das
deutsche Handbuch "durfte" man später nachkaufen...) Den 610 konnte
man auf 256 KB RAM nachrüsten: 16 IC-Sockel einlöten (dazu 256 Lötaugen freilöten),
16 RAM-Chips einstecken, und wundern... Denn erst durch Austtausch der ROM-Chips
erkennt das Betriebssystem den größeren Hauptspeicher! Kleiner Bug am Rande:
Wie bei einer Schreibmaschine ertönt ein Glockenton aus den internen
Lautsprecher, wenn man beim Tippen die 75. Spalte erreicht. So kann man
rechtzeitig die Basic-Zeile beenden. Leider funktioniert diese Routine nicht nur
im EDIT-Modus, sondern immer! Sobald der Cursor die 75. Spalte erreicht, bimmelt
der Rechner. Bei einer Textverarbeitung kann das ja noch recht sinnvoll sein
(auch wenn die den Zeilenumbruch lieber selber macht), doch wenn es auch bei
Bildschirmausgaben dauernd klingelt, wird es nervig. Denn auch bei
PRINT-Befehlen wird geläutet! So mußte der Programmierer bei Bildschimausgaben
den Lautsprecher abschalten, um den Anwender zu schonen...
Ein
weiteres Produkt, daß man zwar bis zur Marktreife brachte, dann aber doch
wieder fallen ließ, ist der C900. Ein auf Unix basierender Computer mit einer
16-Bit-CPU von Zilog (Z8000), 512 KB RAM (auf 2 MB erweiterbar), IEEE488-Bus,
Festplatte von 20-87 MB, Textmodus mit 80x24 Zeichen, Grafik bis 1024x800,
Betriebssystem OS UNIX bzw. Coherent, 1,2 MB-5,25-Zoll-Floppy, und Mausanschluß,
so hätte er ein recht erfolgreicher Workstation-Rechner werden können (damals
gab es noch nicht allzuviele Workstations mit Grafikausgabe und Mausunterstützung!)
Allerdings entschied das Management, daß CBM erstmal viele Homecomputer
verkaufen sollte, statt nur wenige Highend-Geräte. So gibt es nur etwa 500
Prototypen vom C900.
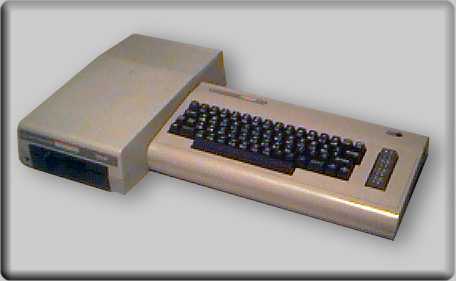 Anfang 1982 hatte CBM etliche neue Produkte in der Entwicklung, darunter den
legendären C64.
Tramiel wußte, um erfolgreich zu bleiben, muß man Gewinner sein. Die
Entwicklungsabteilung, die bereits den VC-20
herausgebracht hatte, wurde verstärkt. Es entstand ein recht einfach
aufgebauter Computer mit besseren Grafik- und Soundfähigkeiten sowie mehr
Speicher, als die anderen Heimsysteme bieten konnten.
Anfang 1982 hatte CBM etliche neue Produkte in der Entwicklung, darunter den
legendären C64.
Tramiel wußte, um erfolgreich zu bleiben, muß man Gewinner sein. Die
Entwicklungsabteilung, die bereits den VC-20
herausgebracht hatte, wurde verstärkt. Es entstand ein recht einfach
aufgebauter Computer mit besseren Grafik- und Soundfähigkeiten sowie mehr
Speicher, als die anderen Heimsysteme bieten konnten.  Der
Soundchip war der erste, den Commodore extra für einen Homecomputer
entwickelte, statt wie bisher, bestehende ICs einzubauen. Der Entwickler, Bob
Yannes, konnte sich so richtig austoben, und Funktionen teurer Profi-Synthesizer
(z. B. Filter und Audio-Eingang) integrieren. Aus Kostengründen entschied man
sich wieder für das Gehäuse des VIC-20. So unterscheidet er sich von seinem
Vorgänger optisch nur in der Farbe. 64 KB RAM waren damals eine Domäne der
Profirechner. Und dieser Homecomputer mit Fähigkeiten, die manche Bürorechner
nicht bieten konnte, wurde auf die selbe Art wie der VC-20 vermarktet: in
Spielwarenketten wie Toys 'R' Us. So erreichte der C64 gleich die richtigen Käufer:
den Heimanwender. Diese Kundschaft wurde vom elitären Gehabe der klassischen
Computergeschäfte abgeschreckt, aber bei den Ketten gingen sie ein und aus, um
die Barbie-Puppen für ihre Kinder zu kaufen. Da konnten sie dann gleich noch für
Papi den Heimcomputer mitnehmen. Allerdings gaben diese Ketten keinerlei Rat,
Hilfestellung und Service, das sparte Personal und die eingesparten Kosten
machten den C64 billig. War das Gerät defekt, wurde es nur umgetauscht, hatte
man Softwareprobleme, dann belästigte man nicht den Verkäufer damit, sondern
wendete sich an Zeitschriften und Computerclubs. Die klassischen CBM-Händler
verkauften die 8000-Serie am liebsten gleich mit Wartungsvertrag, so etwas
machte aber kein Privatkunde.
Der
Soundchip war der erste, den Commodore extra für einen Homecomputer
entwickelte, statt wie bisher, bestehende ICs einzubauen. Der Entwickler, Bob
Yannes, konnte sich so richtig austoben, und Funktionen teurer Profi-Synthesizer
(z. B. Filter und Audio-Eingang) integrieren. Aus Kostengründen entschied man
sich wieder für das Gehäuse des VIC-20. So unterscheidet er sich von seinem
Vorgänger optisch nur in der Farbe. 64 KB RAM waren damals eine Domäne der
Profirechner. Und dieser Homecomputer mit Fähigkeiten, die manche Bürorechner
nicht bieten konnte, wurde auf die selbe Art wie der VC-20 vermarktet: in
Spielwarenketten wie Toys 'R' Us. So erreichte der C64 gleich die richtigen Käufer:
den Heimanwender. Diese Kundschaft wurde vom elitären Gehabe der klassischen
Computergeschäfte abgeschreckt, aber bei den Ketten gingen sie ein und aus, um
die Barbie-Puppen für ihre Kinder zu kaufen. Da konnten sie dann gleich noch für
Papi den Heimcomputer mitnehmen. Allerdings gaben diese Ketten keinerlei Rat,
Hilfestellung und Service, das sparte Personal und die eingesparten Kosten
machten den C64 billig. War das Gerät defekt, wurde es nur umgetauscht, hatte
man Softwareprobleme, dann belästigte man nicht den Verkäufer damit, sondern
wendete sich an Zeitschriften und Computerclubs. Die klassischen CBM-Händler
verkauften die 8000-Serie am liebsten gleich mit Wartungsvertrag, so etwas
machte aber kein Privatkunde.
Zwar hatte der C64 am Anfang massive Qualitätsprobleme (etwa 25% waren
innerhalb einer Woche nach Kauf defekt), aber die Geräte wurden ja sofort
ausgetauscht, der Kunde war glücklich, daß alles so schnell über die Bühne
ging und keiner redete groß darüber. Glücklicherweise bekam man innerhalb
eines halben Jahres die Fertigung besser in den Griff, die Fehlerrate sank auf
damals übliche 4%. 1983 schaffte man es, eine C64-Platine, eine Floppyplatine,
ein Floppylaufwerk, ein Netzteil und einen Farbmonitor (5 Zoll) in ein
gemeinsames Gehäuse zu integrieren, und so den ersten portablen (schleppbar bei
ca 17 kg Gewicht) Farbcomputer herzustellen und als SX64
zu vermarkten. Leider war er etwas zu früh und vor allem zu teuer, um ein großer
Erfolg zu werden.
Kurze
Zeit wurde im US-Bildungsmarkt der 4064 vertrieben: Ein C64 in einem 4032-Gehäuse.
(Leider ist mir nicht bekannt, ob er einen internen Lautsprecher, eingebaute
Floppy oder sogar einen Farbbildschirm hatte.)
Bis 1984 hatte CBM 4 Millionen Rechner weltweit verkauft und pro Monat gingen
weitere 300.000 Stück über die Ladentheken. Der C64 war der erfolgreichste
Homecomputer geworden. Und Tramiel glaubte weiter an den Erfolg, denn erst 6%
aller US-amerikanischen Haushalte hatten einen Computer. In der besten Zeit der
Videogames hatten 25% ein Videospiel gekauft, diese Zahl wollte Jack auch
erreichen.
Ab 1990 stiegen die Verkaufszahlen, die durch den Amiga
und Konsorten sanken, noch einmal enorm an. Die Öffnung des Ostblocks und der
Fall der Mauer sorgen für Nachfrage an billigen Computern. Hatte vorher ein
C64-System in der DDR bis zu 25.000 Ostmark gekostet, gab es das Gerät mit
Floppy und Monitor NEU für weniger als 500 DM. Bis zur Produktionseinstellung
1993 wurden weltweit mehr als 22 Millionen Computer verkauft. Mehr Geräte des
selben Typs hat niemals eine andere Computerfirma geschafft. Und überboten
werden kann diese Zahl auch nicht mehr, da die Rechner sich inzwischen in immer
kürzeren Abständen abwechseln.
Warum
wurde der C64 so erfolgreich? Nun, zum einen wohl der damals riesige Speicher
von 64 KB, seine damals großartigen Grafik- und Soundfähigkeiten. Der
Soundchip "SID" ist wohl der beste, jemals in einen Computer verbaute
Klangerzeuger (Von Soundkarten der PCs reden wir nicht, die können nur Samples
abspielen.). Er hat Filter, die Klänge ermöglichen, die den damals teuer zu
kaufenden Profisynthesizern durchaus nahekommen. Die Erfindung des
"Sprite", eines 24 x 20 Pixel großen Bildes, das der Videoprozessor
selbsttätig auf dem Bildschirm bewegt, ohne daß der Hauptprozessor diese
Grafikdaten ins Video-RAM einkopieren muß, ist zwar nicht direkt von Commodore
(Ataris Computer der 400/800-Serie hatten etwas ähnliches schon 1978). Aber
erst die CBM-Sprites wurden vom Grafikchip (den man schon fast Grafikprozessor
nennen darf) auf Kollision untereinander bzw. mit dem Hintergrund überwacht.
Das war ein Novum und vereinfachte die Programmierung von Spielen enorm. Und
durch einen Programmiertrick lassen sich die Sprites vervielfachen, so daß man
64 Sprites darstellen kann.
Aber der eigentliche Grund für den Erfolg des C64 liegt wohl darin begründet,
daß er seine Fähigkeiten dem Anwender nicht preisgibt. Ohne Erweiterungen kann
man die Sound- und Grafikfähigkeiten nur durch endlose POKE- und PEEK-Orgien
steuern. Die Kommunikation mit den Peripheriegeräten geschieht über serielle
Interfaces mit einer Geschwindigkeit von 500 Zeichen in der Sekunde. So konnte
CBM den Rechner preiswert anbieten. Demzufolge verkaufte er sich recht gut. Die
Zubehörindustrie entdeckte ihn und bot schnell Erweiterungen an, um die in ihm
schlummernden Fähigkeiten dem Anwender erreichbar zu machen.
Spieleprogrammierer schufen neue Genres, die nur mit den Sprites möglich waren,
und auf anderen Computern nicht oder erheblich langsamer abliefen. So war ein
bald unüberschaubares Angebot an Soft- und Hardware für den C64 am Markt. Wer
sich einen neuen Rechner kaufen wollte, orientierte sich nicht nur am Preis,
sondern auch am Angebot. Und das war für den 64'er eben riesig. So wurde der
C64 der erste Selbstläufer der Computergeschichte, der kaum Werbung brauchte,
dem Hersteller immer guten Gewinn schaffte (viele spätere Experimente wurden
mit den Gewinnen des C64 bezahlt) und der Konkurrenz die Luft abdrehte.
Zeitweise hatte Commodore über 75% Marktanteil!
Vielleicht ist diese Dominanz der Grund, warum man später so wenig Werbung für
seine Produkte machte und darauf baute, daß sich Systeme wie der Amiga, das
CDTV oder CD32 von allein bzw. nur durch Mundpropaganda verkauften.
Wir
unterbrechen den historischen Ablauf ein wenig und schieben hier einen Abschnitt
über die Commodore Massenspeicher ein. Sie sind es wert, nicht nur in Nebensätzen
abgehandelt zu werden.
Im
Gegensatz zu den 1977 vorhandenen Systemen sollte der PET in der Grundversion
preiswert sein, aber trotzdem externe Peripherie wie Floppys oder Drucker
ansprechen können. Die damals weit vertretenen CP/M-Systeme hatten
Floppy-Unterstützung entweder gleich auf dem Motherboard, oder es war eine
Schnittstellenkarte irgendwo eingesteckt. Der Druckeranschluß lief ähnlich.
Die Entwickler des PET bekamen die Vorgabe, bereits die Grundversion auf solche
externen Geräte vorzubereiten, aber ohne teure (und möglicherweise von Kunden
ungenutzten) Chips oder Steckkarten. So kam man auf einen 8-Bit breiten,
parallelen Bus, die IEEE488-Schnittstelle. Entwickelt von HP, um ihre teuren Meßgeräte
mit ihren noch teureren Mini-Computern zu verbinden, war sie von der
amerikanischen Normungsbehörde übernommen worden. Maximal 16 Geräte sind am
Bus möglich, alle Geräte werden einfach über Stecker verbunden, der Computer
hat nur eine Buchse, per Kabel wird das erste Gerät der Kette mit dem Rechner
verbunden, das zweite Gerät mit dem ersten, usw. (Daisy Chaining). Mit nur
einem einzigen parallelen Treiberbaustein im Computer können alle Geräte
betrieben werden, den Rest macht clevere Software.
Der Nachteil bei diesem Bussystem ist es aber, daß die angeschlossenen Geräte
intelligent sein müssen. Sie müssen wissen, unter welcher Adresse (von 0 bis
15) sie angesprochen werden, und immer den gesamten Datenstrom, der über den
Bus läuft, mithören. Kommt ihre Adresse, werden sie aktiv, und kommunizieren
mit dem Rechner, ansonsten bleiben sie passiv. Deswegen sind die Floppys,
Drucker, Plotter, usw. von Commodore mit einem eigene Prozessor, eigenem RAM,
ROM usw. ausgestattet. (Im Prinzip sind sie kleine Computer mit einer
Spezialaufgabe, z. B. Papier bedrucken.) Deswegen war eine CBM-Floppy immer
teurer als eine Floppy für einen beliebigen anderen Rechner. In diesen anderen
Rechner ist der nur Computer intelligent, die Floppy nur ein nacktes Laufwerk
ohne Eigenintelligenz.
Der größte Nachteil ist aber auch der größte Vorteil des Systems: Die
Peripherie ist intelligent. Der Computer braucht kein DOS, das macht das
Laufwerk selber. Die Diskette wird vom Floppylaufwerk selbsttätig formatiert,
der Rechner kann in der Zwischenzeit andere Dinge erledigen. Das Konzept geht
sogar noch weiter: Buscontroller kann JEDES Gerät sein, nicht nur der Computer.
Z. B. kann der Rechner einen Datenaustausch zwischen einer Floppy als
Datenquelle und einem Drucker als Datensenke initiieren, und sich dann anderen
Aufgaben zuwenden. Die Floppy als neuer Buscontroller steuert den Datenfluß zum
Drucker. Ist der Datentransfer abgeschlossen, geben beide Geräte den Bus wieder
selbsttätig frei.
Die Datenübertragung war für 1977 recht schnell (20 - 30 KB/sek). Jedoch war
im PET-Betriebssystem ein Fehler enthalten. Programme wurden zwar abgespeichert,
ließen sich nicht mehr laden, da die LOAD-Routine immer abstürzte. Auf Anfrage
verkaufte CBM bzw. der jeweilige Händler das neue ROM für teures Geld. Die
nach Auslieferung der Floppy 2031 hergestellten PETs bekamen zwar das neue ROM,
aber etliche standen ja noch bei den Händlern, die wurden nur auf Kundenanfrage
umgerüstet.
Im
Laufe der Zeit kamen neue Rechnergenerationen auf den Markt. Immer wurden dazu
neue Floppys angeboten. So gehört zum PET die Floppy 2031 mit 160 KB Kapazität
(5,25-Zoll, Single sided, Double Density, 36 Tracks). Die CBM-3000-Serie bekam
die 3040 (selbe Daten, neues Gehäuse). Zur CBM-4000-Serie gab es die 4040
(jetzt 40 Tracks). Die 8000-Serie bekam die 8050 (Doppelfloppy mit ZWEI
Laufwerken à 500 KB! Single sided, 76 Tracks). Weil es eine Doppelfloppy ist,
kann das Laufwerk selbsttätig (ohne den Rechner zu benutzen und ohne Daten über
den Bus zu transferieren) eine Diskette kopieren. Die große Schwester, die
8250, hatte zwei ZWEIseitige Laufwerke (je 1 MB Kapazität) und kann bis 2 MB
(auf zwei Disketten verteilt) abspeichern. Alle Doppelfloppys wurden im selben
Gehäuse angeboten, ein massives Stahlblechgehäuse mit 1 mm Wandstärke.
Der Wechsel zum 8032 SK (die Rechner wurden jetzt in ein ergonimischeres
Kunstoffgehäuse verpackt) machte eine passende Floppy nötig. Die 8250LP (Low
Profile) ist technisch identisch zur 8250, jedoch kommen flachere Laufwerke zum
Einsatz, so daß das gesamte Gehäuse kleiner ausfallen konnte. Davon gibt es
auch eine Einzelfloppy, die SFD 1001 (Single Floppy Disk 1001 KB Kapazität).
CBM baute auch zwei Festplatten mit 5 und 7,5 MB Kapazität. Sie waren laut und
genauso langsam wie die Floppys.
Als
man den VC-20 konzipierte, war klar, daß auch er Floppys braucht. Jedoch mußte
er preiswert sein, also auch die Peripherie. Das Laufwerk wurde wieder einseitig
mit 170 KB Kapazität. Den teuren, parallelen IEE488-Bus ersetzte man durch
einen seriellen Bus mit 5 Kabeln (es kommen Video-Überspielkabel zum Einsatz,
die konnte man im Gegensatz zu den teuren IEEE488-Kabeln preiswert überall
erwerben). Waren in den alten Floppys noch ZWEI CPUs eingesetzt worden (eine
steuert die Laufwerke, die andere verwaltet den Bus), wurde in der VC 1540 nur
noch eine CPU verwendet, die sich im Multitasking mal um den Bus, mal um das
Laufwerk kümmern muß. Statt 4 KB FloppyRAM wurde der Speicher auf 2 KB
zusammengestrichen. Leider wurde das Betriebssystem der Floppy nicht neu
erstellt, sondern aus dem DOS der 8250 übernommen und angepaßt. Fehler waren
die Folge.
Für
den C64 wurde die 1541 aus der 1540 gezüchtet. Bis auf einen einzigen Befehl
mehr (Man kann sie in einen speziellen VC20-Modus schalten) ist sie mechanisch
und elektrisch identisch. Lediglich die Gehäusefarbe wurde dem neuen Rechner
angepaßt. Wie ihr Vorgänger hat sie erhebliche Fehler im Betriebssystem: Es
gibt einen Befehl zum Überschreiben einer Datei (man muß die alte Datei nicht
erst löschen, um sie dann neu zu sichern, ideal beim Programmieren). Nur
benutzen sollte man ihn nicht. Bei gewissen Gelegenheiten (wenn die Diskette
fast voll ist), neigt er durch einen simplen Buchstabendreher im
Assemblerlisting dazu, nicht nur das zu sichernde Programm nicht zu speichern,
sondern das im Verzeichnis der Diskette davor liegende Programm auch noch zu
zerstören! Außerdem mußte die gesamte Mechanik recht preiswert aufgebaut
sein, um einen Verkaufspreis von anfangs DM 1000 zu ermöglichen. (Die großen
CBM-Laufwerke kosteten bis zu 5000 DM.) Sie ist extrem langsam wegen der
seriellen Übertragung zum Computer. Noch dazu ist das Protokoll entsetzlich
umständlich programmiert. Sogenannte Software-Speeder holten durch ein
effizienteres Bustiming die achtfache Geschwindigkeit heraus. Statt 2 Minuten für
40 KB brauchten sie nur 15 Sekunden!
Ein weiteres Problem stellt die Laufwerksmechanik selber dar. Um den Lesekopf
auf die Spur Null zu positionieren, sitzt kurz vor dem mechanischen Anschlag bei
anderen Floppys eine Lichtschranke. Die 1541 hat keine, sollte es zu Lesefehlern
kommen, wird der Kopf in Grundstellung gefahren, indem man ihn 10mal gegen den
Anschlag fahren läßt. Dann müßte er endlich auf Spur Null angekommen sein,
so die dahinterstehende simple Logik. Das dabei entstehende
maschinengewehrartige Geräusch klingt nicht nur ungesund, es ist es auch: Die
Verbindung zwischen den Steppermotor und dem Lesekopf ist nicht besonders
stabil. Bei zu häufigem Anschlagen verstellt sich die Mechanik dauerhaft und muß
in einer Fachwerkstatt justiert werden. Abhilfe schafft hier eine einzige
Basic-Zeile: Irgendwo im RAM der Floppy steht ein Zahlenwert. Er stellt die
Pause zwischen zwei Step-Impulsen dar. Verkürzt man ihn per Floppy-RAM-Write,
so bewegt sich der Kopf nicht nur schneller, die Pausen zwischen den Anschlägen
werden auch kürzer. Da der Kopf in den kürzeren Pausen nicht mehr so weit zurückschwingt,
schlägt er nicht mehr so heftig gegen den Anschlag. Das Geräusch wird leiser,
die Mechanik geschont. Aber es gibt noch ein gravierendes Problem bei der 1541:
Da das Netzteil im Laufwerksgehäuse untergebracht ist, erwärmt es bei längerem
Betrieb das gesamte Laufwerk. Die komplizierte Mechanik dehnt sich
unterschiedlich aus, so kommt es schnell zu Lese- oder Schreibfehlern. Abhilfe:
Die Floppy offen betreiben oder einen Lüfter einbauen.
Zu
neuen Computern der 264/364-Serie (C16/C116/Plus4) schuf man eine neue Floppy.
Im selben Gehäuse wie die 1541 (aber dunkelbraun, fast schon schwarz), wurde
die 1551 mechanisch und elektrisch verbessert. Statt des alten ALPS-Laufwerk
setzte man ein Mitsumi-Chassis ein, das wesentlich unempfindlicher gegen
Lesekopf-Verstellung war. Äußerliches Kennzeichen: Kein Klappenverschluß,
sondern es muß ein Knebel gedreht werden. Erstmals im Heimcomputer-Segment von
CBM ging man zum parallelen Datentransfer über. Jedoch spendierte man den
264ern keinen IEEE488-Bus, sondern man dachte sich eine Eigenentwicklung aus. In
den Expansionsport der Plus4 steckt man ein sog. Paddle (im Prinzip ein Modul
mit ROM und einem Parallel-Treiber-IC). Per Kabel ist dieses mit der Floppy fest
verbunden. Die Transferrate ist etwa 4mal höher als die der alten, seriellen
Verbindung. Für ein Parallelkabel eine enttäuschend schlechte Leistung. Natürlich
kann man an den C16 auch die alte 1541 anschließen... Per Software-Speeder ist
man dann schneller als mit der 1551 im Werkszustand... Übrigens: Das DOS der
1551 wurde stark überarbeitet, um den Parallelbetrieb zu ermöglichen. Leider
wurden aber nicht alle Fehler der vorhergehenden Versionen ausgemerzt.
Zum
C128 brauchte man eine komplett neue Floppy, weil der Computer auch CP/M konnte.
Um Disketten anderer CP/M-Rechner lesen zu können, benötigte man eine neue
Elektronik. Alle CBM-Floppys davor zeichnen ihre Daten im GCR-Verfahren auf.
Hierbei wandelt der im Laufwerk eingebaute Prozessor die zu schreibenden Daten
um und steuert den Bitstrom zum Schreibkopf selbst. In CP/M-Systemen gibt es
einen Floppycontroller, auf dem ein IC diese Aufgabe erledigt, und die Daten im
MFM-Format speichert. So brauchte die 1571 sowohl GCR als auch MFM. GCR erledigt
wieder der Prozessor, für MFM wurde ein normaler Western Digital
Floppycontrollerchip eingebaut. Das DOS entscheidet selbsttätig, mit welcher
Art es die Daten lesen/schreiben muß und schaltet entsprechend um. Da das DOS
erheblich umgeschrieben werden mußte, kamen zu den alten Fehlern mehr neue
hinzu, als alte beseitigt wurden... Zum Beispiel kann man bei allen CBM-Floppys
Dateien schreibschützen. Bei der 1571 sind diese Dateien auch vor dem Lesen
geschützt, bei Leseversuchen erhält man die Fehlermeldung "File not
Found"! Zum Ausgleich war die 1571 wieder zweiseitig. Und schneller, denn
man baute im Betriebssystem der Floppy und des C128 Burst-Routinen ein, die bis
zu achtmal schneller als die alten Busprotokolle waren. Die Wärmeprobleme gehörten
der Vergangenheit an, da man das Netzteil im Gehäuse vollständig einblechte.
Zusätzlich gab es endlich wieder eine Lichtschranke für die Spur-Null-Abfrage.
das Rattern gehörte der Vergangenheit an.
Detail am Rande: Die 1571 ist die erste CBM-Floppy, bei der man die Adresse von
außen einstellen kann. Zwar konnten auch die alten Laufwerke von Adresse 8 auf
9-11 umgeschaltet werden, jedoch nur durch Öffnen des Gehäuses (mit
Garantieverlust) und Durchtrennen einiger Leiterbahnen. Es gab sogar einen
Prototyp mit zwei Laufwerken in einem Gehäuse, die Doppelfloppy 1572, die
wieder selbständig kopieren konnte.
Da man bei der Herstellung der 1571 die Nachfrage nicht befriedigen konnte (der
Hersteller des Chassis lieferte nicht genügend Rohlaufwerke), gab es als
Verlegenheitslösung die 1570. Eine Kreuzung aus Platine der 1571 und Mechanik
der 1541 im Gehäuse der 1541 entstand. Sie hat alle Vor- und Nachteile der
1571, aber zusätzlich die Wärmeprobleme der 1541. Und weil sie nur einseitig
ist, kann sie zwar im Prinzip für CP/M genutzt werden, aber kaum Disketten
anderer Computer lesen, die damals standardmäßig doppelseitig waren. So
bezahlte man den Preisunterschied von 200 DM (800 DM statt 1000 DM für die
1571) mit großen Nachteilen.
1987
gab es wieder ein neues Laufwerk: Die 1581. Es ist ein normales 3,5-Zoll-720-KB
Laufwerk, wie es in PCs und Amigas eingesetzt wurde (allerdings durch 10
Sektoren pro Track insgesamt mit 800 KB). Damit es am IEC-Bus funktionierte,
wurde wieder ein Minicomputer verwendet. Es verhält sich dem Computer gegenüber
genau wie eine 1571, aber die Daten werden auf der Diskette in MFM gesichert.
Weil auch ein Standard-Controller-Chip das Laufwerk steuert, muß der
Floppyprozessor zwischen logischen Sektoren (mit 254 Bytes Daten) für den
Computer und echten Sektoren (mit 512 Bytes) auf der Diskette übersetzten.
Deswegen bekam die 1581 16 KB RAM, so daß immer ein gesamter Zylinder (alle
Sektoren eines Track auf Ober- und Unterseite) im Speicher gepuffert wird, Lese-
und Schreibzugriffe gehen grundsätzlich über diesen Puffer, erst bei einem
Trackwechsel wird der Zylinder komplett geschrieben und der neue eingelesen. Das
machte das Laufwerk schneller. Und weil das DOS sowieso stark umgeschrieben
werden mußte (bei dieser Gelegenheit wurden alle bei den alten Floppys
genannten Fehler aus dem DOS entfernt!), um den PC-Chip ansteuern zu können,
spendierte man der 1581 als erste (und letzter) 8-Bit-Floppy Unterverzeichnisse.
Das DOS paßte nun nicht mehr in 8 KB-ROMs, so griff man zu größeren 16
KB-EPROMs. Da dort aber noch viel Platz war, findet man viele Botschaften der
Programmierer. Es gibt sogar Befehle, die nichts anderes bewirken, als daß man
einen Gruß an die Frau des DOS-Entwicklers Frau zurückbekommt!
Leider ist sie durch die neue Hard- und Software sehr inkompatibel, Spiele kann
man kaum auf 3,5-Zoll umkopieren. Und die Verzeichnisse werden eigentlich erst
von GEOS
so richtig ausgenutzt. So ist der einzige Vorteil der enorme Platz auf dem
Laufwerk, auf eine Diskette paßt fast 5mal so viel, wie auf eine 1541.
Passend
zum C64-II gab es ab 1986 einen neue 1541-II. Die Hardware ist im Prinzip
identisch der alten 1541, lediglich wurden mehrere ICs zu höherintegrierten
Chips zusammengefaßt. Um die bekannten Wärmeprobleme zu umgehen, hat man
einfach ein externes Netzteil gewählt. Noch mehr Kabelsalat am Rechnerplatz war
die Folge. Und das DOS wurde unverändert mit den alten Fehlern übernommen...
Der
Amiga hat, im Gegensatz zu den intelligenten Laufwerken der CBMs, VCs und Cs,
"dumme" 3,5-Zoll Shugart-Bus Laufwerke mit 880 KB. Der
Floppycontroller sitzt im Computer, die Laufwerke werden extern angeschlossen
und haben (fast) immer eine Buchse, wo man das nächste Laufwerk einstecken
kann. So sind maximal 4 Floppys möglich. Da der Amiga eine eingelegte Diskette
sofort erkennt und auf der WorkBench ihr Symbol anzeigt, bzw. entnommene
Disketten sofort abmeldet, greift er alle zwei Sekunden auf alle angeschlossenen
Laufwerke zu. Ist in einem Laufwerke keine Diskette eingelegt, hört man dann
jedesmal ein "Klick" aus der Floppy. Bei 3 oder 4 Laufwerken, die alle
zwei Sekunden klicken, eine nette Untermalung der Arbeit. (Mittels
Shareware-Tool "NoKlick" ließ sich das abschalten).
Zum A3000 wurde endlich, der Zeit gemäß, eine HD-Floppy präsentiert. Im PC
und Mac zählte sie bereits lange zum Standard, doch der Amiga steuerte das
Laufwerk über einen Spezial-Chip an. Im PC half man sich beim Wechsel auf HD
mit einem neuen Controller, der doppelt so schnell getaktet wird, und so bei
immer noch 300 Umdrehungen pro Minute die doppelte Datenmange auf Diskette
bringt. Bei CBM dachte man anders herum. Die speziell für Commodore
angefertigte Floppy kann sich mit nur 150 U/min drehen, so kann der unveränderte
Chip die doppelten Daten auf das Medium schreiben. Zwar hatte man bis zu 1760 KB
auf der Diskette, doch die Schreib- bzw. Lesegeschwindigkeit bleibt unverändert.
Die Konsequenz: HD-Disketten sind auf dem Amiga nur halb so schnell wie auf
allen anderen Computern.
 Jack
Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte
alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was
ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem
Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein
Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng
hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft
aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne
in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von Gould
und dem Aufsichtsrat. Tramiel verlor am 13. 1. 1984 seinen Posten als Präsident,
verkaufte seine restlichen Aktien und verließ CBM endgültig. Nach einem halben
Jahr des Nichtstuns und Umherziehens war er der Langeweile leid und kaufte vom
Medienriesen Time Warner die angeschlagenen Computer- und Spielefirma Atari.
Dort räumte er mit seinen Methoden rasch auf, entwickelte mit dem mitgenommenen
Vater des C64, Shivji Shivaz, sowie weiteren Ex-Commodore-Entwicklern, eine
neuartige 16-Bit-Computergeneration, die ST-Linie.
Jack
Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte
alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was
ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem
Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein
Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng
hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft
aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne
in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von Gould
und dem Aufsichtsrat. Tramiel verlor am 13. 1. 1984 seinen Posten als Präsident,
verkaufte seine restlichen Aktien und verließ CBM endgültig. Nach einem halben
Jahr des Nichtstuns und Umherziehens war er der Langeweile leid und kaufte vom
Medienriesen Time Warner die angeschlagenen Computer- und Spielefirma Atari.
Dort räumte er mit seinen Methoden rasch auf, entwickelte mit dem mitgenommenen
Vater des C64, Shivji Shivaz, sowie weiteren Ex-Commodore-Entwicklern, eine
neuartige 16-Bit-Computergeneration, die ST-Linie.
Irving Gould holte sich vom Konzern Thyssen-Bornemisza (auf den niederländischen
Antillen) Marshall F. Smith, um Tramiel zu ersetzen. Neben dem Wechsel der Geschäftsleitung
(und der damit verbundenen Änderung der Management-Strategie) war CBM vor einem
weiteren großen Problem. Der Markt für Heimcomputer ging wohl dem Ende
entgegen. Viele andere Firmen wie Texas Instruments, Coleco, Mattel usw. zogen
sich mit hohen Verlusten vom Markt zurück. Einzig der C64
verkaufte sich noch recht zufriedenstellend, aber niemand konnte absehen, ob das
noch länger so weiter gehen sollte.
Um Commodore wieder profitabel zu machen, entließ Smith 45% der Angestellten
und zahlte ein Viertel seiner Schulden an die Banken zurück. Das sorgte natürlich
dafür, daß bei einem Umsatz von 339 Millionen Dollar im zweiten Quartal 1985
nur 1 Million Gewinn herauskam. Und das Fiskaljahr 1985 schloß man insgesamt
mit 237 Millionen Dollar Verlust ab. Das führte zu Problemen mit den Banken,
die sich nur zögernd auf eine Stundung der Zahlungen um einen Monat einließen.
Das Weihnachtsgeschäft 1985 wurde zum Quartal mit den größten Umsätzen der
bisherigen Firmengeschichte, und so konnte CBM den Konkurs gerade noch abwenden
und die Tilgungszahlungen an die Banken wiederaufnehmen.
Doch mit den Tramiels war der begnadete Geschäftsmann gegangen, der Commodore
von Erfolg zu Erfolg geführt hatte. Der Nachfolger Gould wollte nur noch Geld
verdienen, ohne sich groß darum zu scheren, womit man es verdiente. Für ihn
war ein Computer nur ein Gebrauchsgegenstand wie ein Toaster oder ein Auto. Er
hatte einfach keine Visionen, er benutzte sein Zugpferd Amiga niemals selbst.
Neue
8-Bit-Systeme

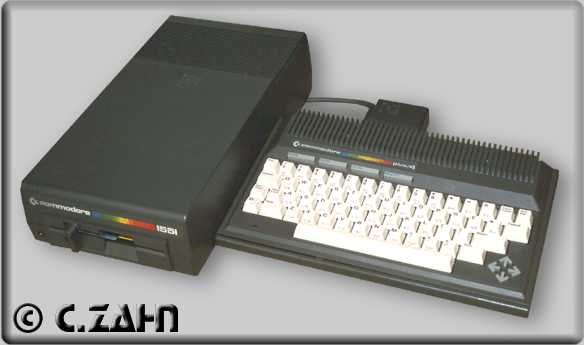 Die
Reste der einstigen Mannschaft entwickeln ein neues 8-Bit-System, das den VC-20
und den C64
ablösen soll. Intern als CBM 264 und 364 bezeichnet, stellten sie unwesentliche
Verbesserungen (teilweise sogar Verschlechterungen) des C64
dar. Die 264-Serie bestand aus C116
als Einsteigermaschine, C16 als
etwas bessere Einsteigermaschine und dem Plus4
als oberstes Modell. Aber der Markt folgte Commodore nicht mehr auf
ein zum C64 inkompatibles System (der andere Speicheraufbau, der andere
Video- und Soundchip, der den Prozessor ausbremst und ohne die genialen 8
Hardwaresprites des C64 und ohne die legendären SID-Sounds auskommen muß; auch
die geänderten Steckerformen sorgten nicht für Freudenstimmung unter den
Anwendern), das dank 16 KB RAM und des primitiveren Videochips erheblich
schlechter war als der C64 (nur der Plus4 stellte mit den vier eingebauten
Programmen zumindest softwareseitig etwas mehr als der C64 zur Verfügung). So wurde
nichts aus dem Nachfolgern; nicht einmal zum Parallelsystem reichte es, die
Computer wurden ab 1986 in Supermärkten (z. B. ALDI) mit Kassettenrecorder und
Basic-Kurs als Lerncomputer verramscht (etwa 100 bis 300 DM, je nach Umfang
des Kartons, teilweise mit Handtüchern, Duschgels, Joysticks, Videospielen
usw).
Die
Reste der einstigen Mannschaft entwickeln ein neues 8-Bit-System, das den VC-20
und den C64
ablösen soll. Intern als CBM 264 und 364 bezeichnet, stellten sie unwesentliche
Verbesserungen (teilweise sogar Verschlechterungen) des C64
dar. Die 264-Serie bestand aus C116
als Einsteigermaschine, C16 als
etwas bessere Einsteigermaschine und dem Plus4
als oberstes Modell. Aber der Markt folgte Commodore nicht mehr auf
ein zum C64 inkompatibles System (der andere Speicheraufbau, der andere
Video- und Soundchip, der den Prozessor ausbremst und ohne die genialen 8
Hardwaresprites des C64 und ohne die legendären SID-Sounds auskommen muß; auch
die geänderten Steckerformen sorgten nicht für Freudenstimmung unter den
Anwendern), das dank 16 KB RAM und des primitiveren Videochips erheblich
schlechter war als der C64 (nur der Plus4 stellte mit den vier eingebauten
Programmen zumindest softwareseitig etwas mehr als der C64 zur Verfügung). So wurde
nichts aus dem Nachfolgern; nicht einmal zum Parallelsystem reichte es, die
Computer wurden ab 1986 in Supermärkten (z. B. ALDI) mit Kassettenrecorder und
Basic-Kurs als Lerncomputer verramscht (etwa 100 bis 300 DM, je nach Umfang
des Kartons, teilweise mit Handtüchern, Duschgels, Joysticks, Videospielen
usw).
Die vier eingebauten Programme des Plus4 wurden über eine Funktionstaste
aufgerufen und bestanden aus Textverarbeitung (die NUR mit dem Commodore-Drucker
MPS 801 klarkam, und der war inkompatibel zu allem anderen auf dem Markt),
Datenverwaltung und Tabellenkalkulation sowie grafischer Aufbereitung von Daten
bzw. Tabellen. Aber gerade diese grafische Aufbereitung war so schlecht
(sie nutzt die Grafikfähigkeiten des Rechners nicht einmal im Ansatz aus,
die Aufbereitung besteht aus waagrechten weißen Balken aus #-Zeichen vor einem
schwarzen Hintergrund ohne jede Beschriftung), daß alle Tester schrieben, den
ROM-Speicherplatz hätte man besser nutzen können, etwa für ein Spiel oder für
vom Anwender selber einzusetzende ROMs oder sonstwas...). Commodore zeigte
nicht, was der Computer alles konnte, die Qualität der Software entsprach etwa
dem Stand von 1977 auf dem PET.
Die 364-Serie kam über das Planungsstadium gar nicht hinaus. Er sollte ein 264
mit mehr eingebauten Programmen und einem Chip zur Spracherzeugung sein. (Das
hatte man in den Entwicklungslabors von Atari
auch vor. Und auch dort wurde nichts marktreifes daraus.) Ob die Qualität der
mitgelieferten Programme über der Plus4-Software liegen sollte, ist unklar. Und
auch der 232 wurde nicht fertiggestellt. Es sollte eine Art Plus4 werden, jedoch
ohne Userport, mit nur 32 KB Speicher und ohne eingebaute Software.
Und sogar eine Art Laptop entwickelt man: den Commodore LCD mit 40x8
Zeichen-LCD-Display, 6502 CPU, 32 KB RAM, eingebaute Software (wie beim Plus4)
und externer batteriebetriebener Floppy (3,5 Zoll!). Auch dieser as auf den
Markt gebracht.
 1985
1985
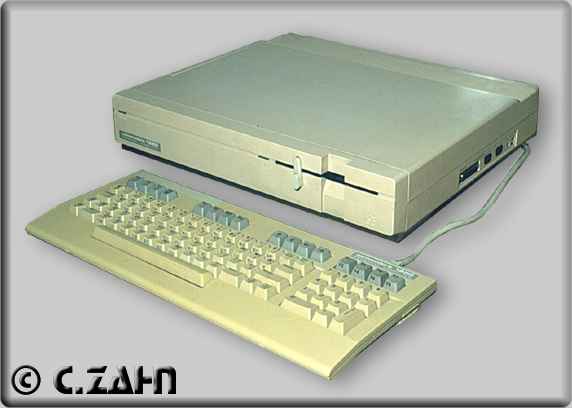 entwickelte
die USA einen weiteren Heimcomputer, den C128.
Er ist ein Rechner mit drei Betriebssystemen, zum einen die 128er Betriebsart
mit 2 MHz und 128 KB RAM, dann ist er kompatibel zum C64
in einem speziellen C64-Mode mit 1 MHz und nur 64 KB RAM, und er kann CP/M,
allerdings aufgrund des geteilten Rechners und der seriellen Floppyverbindung
extrem langsam, professionelles Arbeiten ist nicht möglich. Das Bustiming des
Hauptprozessor (8502) bremst den mit 4 MHz getakteten Z80 so weit aus, (die
Z80-CPU durchläuft enorm viele Waitstates), daß er eine effektive
Taktgeschwindigkeit von knapp 2 MHz hat. Und das CP/M-System greift selber nicht
auf die I/O-Geräte wie Floppy, Drucker, Tastatur, Bildschirm usw. zu, sondern
übergibt diese Aufgabe an die 8502 und muß auf die Abarbeitung dieser Aufgaben
warten. Da Laufwerkszugriffe alle über den seriellen Bus zur Diskettenstation
gelangen, ist die Schreib-/ Lesegeschwindigkeit nicht 20 KB/s (wie bei anderen
CP/M-Computern, sondern nur 3 KB/s (bei Verwendung der 1571) bzw. 0,4 KB/s (mit
der 1541).
entwickelte
die USA einen weiteren Heimcomputer, den C128.
Er ist ein Rechner mit drei Betriebssystemen, zum einen die 128er Betriebsart
mit 2 MHz und 128 KB RAM, dann ist er kompatibel zum C64
in einem speziellen C64-Mode mit 1 MHz und nur 64 KB RAM, und er kann CP/M,
allerdings aufgrund des geteilten Rechners und der seriellen Floppyverbindung
extrem langsam, professionelles Arbeiten ist nicht möglich. Das Bustiming des
Hauptprozessor (8502) bremst den mit 4 MHz getakteten Z80 so weit aus, (die
Z80-CPU durchläuft enorm viele Waitstates), daß er eine effektive
Taktgeschwindigkeit von knapp 2 MHz hat. Und das CP/M-System greift selber nicht
auf die I/O-Geräte wie Floppy, Drucker, Tastatur, Bildschirm usw. zu, sondern
übergibt diese Aufgabe an die 8502 und muß auf die Abarbeitung dieser Aufgaben
warten. Da Laufwerkszugriffe alle über den seriellen Bus zur Diskettenstation
gelangen, ist die Schreib-/ Lesegeschwindigkeit nicht 20 KB/s (wie bei anderen
CP/M-Computern, sondern nur 3 KB/s (bei Verwendung der 1571) bzw. 0,4 KB/s (mit
der 1541).
Der C128 ist m. E. der erste Computer der Welt, der zwei Monitore ansteuern kann
(und muß). In der C64-Emulation und als C128 mit 1 MHz Takt steuert er den
alten Chip des C64 und damit einen Videomonitor. Im C128-Modus mit 2 MHz kommt
dieser alte Chip timingmäßig nicht mehr mit, und wird abgeschaltet. Der
Videomonitor wird dunkel. Statt dessen wird jetzt ein neuer Videochip
angesteuert, der eigenes Video-RAM besitzt, das er nicht wie der C64 mit dem
Prozessor teilen muß. So kann man auf einem CGA-Monitor 80 Zeichen pro Zeile in
Farbe scharf darstellen. Für Monochrom-Monitore gab es bald Umschalter, so
konnte man wenigstens mit einem Bildschirm beide Auflösungen darstellen.
Commodore ließ von Thomson, Frankreich einen Monitor, den 1902 bauen, der beide
Modi in Farbe beherrschte. Allerdings war er recht teuer. Das Basic trägt die
Versionsnummer V7.0 und ist total runderneuert. Viel mehr Funktionen als früher
(alle Grafik- und Soundmöglichkeiten sind endlich per Basic-Befehl erreichbar),
Fehlerbehandlung (TRAP), IF-THEN-ELSE, DO LOOP, WHILE ENDWHILE uvm. ermöglichen
endlich strukturierte Programme ohne unübersichtliche GOTO/GOSUB Orgien. Im ROM
finden sich weiterhin ein Maschinensprache-Monitor und ein Sprite-Editor. Leider
wird das Basic durch die Bankswitch-Technik ausgebremst. Da in der ersten
64-KB-Bank der Programmtext und in der zweiten Bank die Variablen abgelegt sind,
muß laufend die Bank gewechselt werden.
Der C128 war als Nachfolger des C64 geplant, jedoch zu ähnlich, um eine
wirkliche Verbesserung darzustellen und nur als schnellerer C64 zu teuer,
deswegen hat er den C64 nicht überlebt, der noch lange nach Produktionsende des
C128 gebaut wurde. Geliefert wurde er in zwei Varianten: Als C128 im Tastaturgehäuse,
dann ist die Floppy extern. Als besseres System C128D, in dessen Gehäuse die
Floppy eingebaut ist, mit externer Tastatur. Commodore-Intern hießen beide
Versionen C128 Low Profile und C128 High Profile. Im C128D ist eine vollständige
1571 verbaut ist, doch sind die Platinen des Computers und der Floppy nur
über ein serielles Kabel miteinander verbunden.
Ca. 1
Jahr später wird eine neue Version, vorgestellt; inoffiziell als C128DB (im
Jargon als "Blechdiesel") bezeichnet. Bei dieser Version wurden
Floppy- und Rechnerplatine auf eine Platine zusammengefaßt und verschiedene
Bauteile höher integriert (billiger, geringere Stromaufnahme, deswegen kein Lüfter
mehr erforderlich), die Floppy ist aber immer noch nur seriell an den Rechner
gekoppelt.
Die Käufer haben den C128 nur sehr zögerlich angenommen, oftmals benutzte man
ihn nur im C64-Modus.
Wir müssen
hier kurz den chronologischen Ablauf der Geschichte unterbrechen und einige
Jahre zurückspringen. Also wieder zu den Anfängen der Achtziger Jahre...
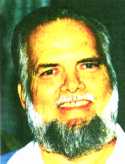 Die
Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und
Soundchips der Atari
2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer
entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von
Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich
dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)
mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser
sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.
Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma
unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem
Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.
Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der
Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten
sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man
"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären
Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen
Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's
Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen
"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -
der Name war gefunden.
Die
Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und
Soundchips der Atari
2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer
entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von
Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich
dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)
mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser
sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.
Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma
unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem
Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.
Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der
Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten
sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man
"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären
Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen
Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's
Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen
"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -
der Name war gefunden.
Das Videospiel, das die Finanziers wollten, erschien den Entwicklern als überholt.
Sie wußten, daß der Markt dafür bald einbrechen mußte, und wollten lieber
einen richtigen Computer, den aber mit herausragenden Grafik- und
Sound-Eigenschaften herstellen. Weil RAM damals noch sehr teuer war, mußte man
Rechenoperationen (und damit Speicherbedarf) in Hardware entwerfen. Der CPU
sollten leistungsfähige Coprozessoren zur Seite stehen. Miner wollte bereits zu
seiner Atari-Zeit einen Rechner auf Basis des 16-Bit-Prozessors Motorola 68000
entwickeln. Doch damals wollte die Geschäftsleitung von Atari
das nicht. So träumte Miner weiter seinen Computertraum, bis er ihn bei Amiga
verwirklichen konnte. Allerdings mußte das Team die Geldgeber etwas betrügen.
Alles, was man schuf, sah wie ein Spiel aus, war aber ein Computer. Der Öffentlichkeit
gegenüber (und der Konkurrenz wie Atari und Commodore) mußte man eine Lügengeschichte
auftischen: Offiziell entwickelte Amiga Zubehör für Videospiele. Als die Späher
der Konkurrenz und die Silicon-Valley-Journalisten
sahen, daß man nur Joysticks entwickelte und verkaufte, konnte man in Ruhe am
Computer weiterarbeiten.
Jay Miner als Chef der Entwicklung schuf ein extrem lockeres Arbeitsklima. Zwar
waren auch bei anderen Firmen im Silicon Valley die Sitten recht locker
(verglichen mit uns biederen Deutschen geradezu anarchisch), doch bei Amiga,
Inc. ging es noch lockerer zu. Wenn ein Angestellter in Hausschuhen zur Arbeit
erschien, verlor man kein Wort darüber. Hauptsache, er tat seinen Job. Carl
Sassenrath bewarb sich als Software-Ingenieur und wurde eingestellt, um die
Entwicklung des Betriebssystems zu leiten. Beim Vorstellungsgespräch sagte man
ihm, er könne machen, was er wollte. "OK, dann mach' ich ein
Multitasking-System." So wurde der Amiga die erste Maschine, die mehrere
Programme gleichzeitig abarbeiten konnte. Weitere Beschäftigte waren R. J.
Mical und Dale Luck für die Systemsoftware, Ron Nicholsen (Blitter-Chip), Dave
Dean (I/O-Chip Denise). Miner entwarf den Grafikchip Agnus und das
Gesamtkonzept.
Trotz allem kam aber recht schnell die erste große Krise. Was die Entwickler
vorausgesehen hatten, trat ein: Der Videospielmarkt brach in sich zusammen.
Niemand wollte mehr Geld für eine Spielekonsole ausgeben, wenn er für nur
wenige Dollar mehr einen "richtigen" Computer erwerben konnte. Bei Atari
fuhr man Spielemodule direkt aus der Produktionshalle auf eine Müllkippe, so
schlecht war der Absatz geworden. Bei Amiga, Inc. war Jay Miner aber
optimistisch. Die Vetriebsleute gerieten in Panik, er nicht, denn der Amiga war
keine halbfertige Konsole, sondern ein halbfertiger Computer, der nur als
Spielkonsole getarnt war. Er schlug einen neuen Entwurf vor: Großes Gehäuse,
mehrere Steckplätze, eingebautes Laufwerk und starkes Netzteil. Mit dem
Marketing stritt man sich längere Zeit, dann kam die Einigung: Gehäuse wie später
das des Amiga 1000, eingebautes 5,25-Floppy-Laufwerk (Apple-II-kompatibel, weil
das damals der meistverkaufteste Computer war), keine Erweiterungssteckplätze,
kleine Tastatur und 64 KB RAM. Miner schaffte es noch, 128 KB durchzusetzten,
mit dem Hintergedanken, diese ICs durch andere zu tauschen, um so später auf
256 bzw. 512 KB aufrüsten zu können.
Im Frühjahr
1983 war das Konzept des Computers größtenteils fertig. Ein vollkommen
neuartiger, geradezu revolutionärer Computer war (auf dem Papier) geboren, auf
den Tischen standen Platinen mit Hunderten von TTL-ICs, die die späteren
Custom-Chips emulierten. Man wollte nicht einfach Geld verdienen, sondern die
Computerwelt entscheidend verbessern. Hochtechnologie einfach verpackt, damit
sie jedermann leicht bedienen konnte. Jedoch mußte noch viel Detailarbeit
geleistet werden (besonders an der Software), bis der Rechner verkaufsfertig
sein würde. Das Arbeitstempo zog immer mehr an, weil den Finanziers langsam,
aber sicher das Geld auszugehen drohte (der Joystickverkauf war auch nicht
gerade gewinnträchtig...). Programmier-Dauerschichten, 48-Stunden-Einsätze am
Lötkolben, Assembler-Nachtschichten - all das häufte sich, bis der Amiga
erstmals auf der CES (Consumer Electronics Show, so bedeutsam wie die CeBit bei
uns) Januar 1984 vorgeführt werden konnte. Kurz zuvor war der Prototyp möglichen
Interessenten vorgeführt worden, darunter Apple, Sony, Philips, HP und anderen.
Die Messepräsentation war ein großer Erfolg, wenn auch der Rechner oft
"abschmirgelte". Er war ja immer noch die Sammlung aus Hunderten von
Einzelchips, die extrem empfindlich, vor allem gegen statische Aufladung war.
Zuhause in den Labors half man sich, indem man barfuß herumlief, auf der Messe
mußte man eben mit einem großen Koffer von Ersatz-Chips schnelle Reparaturen
leisten. Oben auf dem Tisch stand ein fast fertiger Amiga. Jedoch war er ein
Plazebo. Der eigentliche Rechner befand sich unter dem Tisch, der reinste
Drahtverhau. Die Besucher waren "hin und weg". Das berühmte Demo
"Bouncing Ball" (ein sich drehender karierter Ball prallt auf die
Monitorgrenzen und macht dann "Boing", so etwas konnte (weder sound-
noch grafikmäßig) ein anderer Computer leisten. Vielleicht ein paar sündhaft
teure Superworkstations, aber keine andere "kleine Kiste".
Leider reichte die Begeisterung der Messebesucher nicht aus. Keine der großen
Firmen war bereit, in das Projekt Geld zu pumpen. Die Finanzen wurden immer dünner.
Die drei Ärzte wollten nicht noch mehr Kapital nachschießen, sondern endlich
mal Gewinne sehen. Das Ende rückte in greifbare Nähe. Doch Jay Miner (und
viele andere Beschäftigte) nahmen Hypotheken auf, um Amiga, Inc. weiterleben zu
lassen. Miners ehemaliger Arbeitgeber Atari gab 500.000 Dollar Kredit, den man
mit den später anfallenden Lizenzgebühren verrechnete (Atari wollte drei bis
vier der Chips in eigenen Rechnern verwenden, nicht aber den Amiga vertreiben).
Aber im Herbst 1984 trat Jack
Tramiel auf den Plan: Er hatte Commodore verlassen und Atari gekauft. Beim
Durchstöbern der Bücher war er über die 500.000 Dollar gestolpert und
brauchte nur auf die Fälligkeit des Kredits zu warten. Er wußte, daß die
kleine Firma Amiga, Inc. das Geld nicht aufbringen konnte. Dann hätte sie ihm
gehört. So war er bei seinen Verhandlungen nicht zimperlich. Sowieso ein
knallharter Geschäftsmann, drückte er den Kurs, mit dem er die Amiga-Aktien
aufkaufen wollte, immer weiter herunter, bis auf unter einen Dollar pro Aktie!
Die Mitarbeiter waren nicht begeistert. So hätten sie ihre Hypotheken nie zurückzahlen
können. Ein paar Tage vor dem finanziellen Ende flog David Morse (Amigas
Finanzchef) zu den Commodore-Chefs. Die boten ihm 4 Dollar pro Aktie. Er zierte
sich etwas, und verlangte sogar 4,25 Dollar, die er auch bekam. So war Amiga,
Inc gerettet und wurde für den Kaufpreis von 27,1 Millionen Dollar zunächst
eine eigenständige Tochter von Commodore International. Und die Angestellten
bekamen für ihre Amiga-Aktien Commodore-Aktien eingetauscht.
Noch
ein Detail am Rande: Die berüchtigte "Guru-Meditation" ist ein Erbe
der Anfänge von Amiga, Inc. Da man zu Anfang Joysticks herstellen mußte, um
die Konkurrenz abzulenken, entwickelte man unter anderem ein Meditations-Brett.
Auf das setzte man sich und mußte ruhig bleiben, damit der Cursor auf dem
Bildschirm einen bestimmten Punkt erreichte. Es war als Eingabegerät für Ski-
und Surf-Spiele gedacht, aber die Software-Entwickler nutzten es einfach zur
Entspannung. Immer, wen nder Amiga wieder einmal völlig unerklärlich abstürzte
und man der Lösung am Computer nicht näherkam, entspannte sich das Team auf
diesen Joy-Brettern. Dabei mußte man ruhig wie ein Guru sitzen, um die
Spielfigur nicht zu bewegen. Bald hatten Systemabstürze den Spitznamen
"Guru-Meditation" weg und wurden so auch im Betriebsystem verewigt.
Aber Commodore ließ es durch "Software Failure" ersetzten, um seriöser
zu wirken. Nunja, "Guru" dürfte trotzdem witziger gewesen sein...
Die
Entwickler von Commodore International wußten, daß der 8-Bit-Markt am Ende war
und die Zukunft den 16/32-Bit-Maschinen wie Apples
Macintosh gehörte. Der nächste Schritt war also die Veröffentlichung
eines eigenen 16-Bit-Systems. Da die Tramiels aber alle wichtigen Entwickler mit
nach Atari genommen hatten, und dort Gerüchten zufolge bereits tief in der
Entwicklung eines solchen Rechners steckten, wußte man sich bei CBM nicht zu
helfen. Eine neue Mannschaft aufzubauen, die eine komplett neuartige Maschine
aus dem Boden stampfen konnte, das war nicht machbar. Glücklicherweise gab es
eine kleine Firma namens Amiga,
die ein Videospiel auf der Basis des 16-Bit-Prozessors 68000 entwickelte. Dieser
Firma ging allmählich das Geld aus. Sowohl Atari als auch Commodore wollen
Amiga, Inc. aufkaufen. Ein Pokern begann, das CBM schließlich gewann und Amiga,
Inc mit den Entwicklern für 27 Millionen Dollar übernahm. Aus dem Videospiel
mußte nun ein richtiger Rechner werden: das brachte Probleme mit sich.
Commodore wollte einen Computer ähnlich dem IBM-PC.
Miners Konzept sah glücklicherweise von Anfang an einen Computer statt eines
Videospiels vor. Die internen Erweiterungsslots strich das Marketing aus
Kostengründen gleich wieder heraus. Statt dessen präsentierte man Jay ein Gehäuse,
in das er den Amiga bitteschön hineinzupacken hätte. Er war ziemlich entäuscht,
wie CBM mit seinem Traum umsprang. Er hätte lieber gleich etwas gebaut, was wie
der spätere A2000 aussah, statt diesem "bereits bei der Vorstellung
veraltetem System" (Zitat Miner). Er wollte die ursprünglichen Grafik- und
Soundchips (deren Konzept von 1982 war) verbessern und die Möglichkeiten des
Jahres 1984 ausschöpfen. Doch Commodore wollte nicht. Statt dessen sollte der
ursprüngliche Entwurf Miners weiterentwickelt werden.
Da Jay von Anfang an einen Computer, der sich als Spiel tarnte, gedacht hatte,
sollte die Erweiterung eigentlich nicht allzuschwer gewesen sein. Doch es kam
anders: Ein Computer braucht einen Massenspeicher, eine Floppy. Commodore wollte
360KB-5,25-Disketten wie im IBM
PC. Miner nicht. Sie waren ihm zu klein. Er sah die 800 KB 3,5-Zoll-Floppys
des Macintosh.
Da diese einen elektrischen Auswurf und 4 verschiedene Drehzahlen haben, waren
diese Geräte CBM zu teuer. Man einigte sich auf normale
720-KB-3,5-Zoll-Laufwerke, die bereits in anderen Computern (MSX) verwendet
wurden. Durch den Verzicht auf einen Standard-Floppycontroller
(diese Aufgabe erledigt wie beim Mac der Prozessor in Verbindung mit dem
Soundchip Paula) konnte man die Kapazität auf 880 KB erhöhen. Mit den ursprünglichen
Geldgebern hatte man sich auf 256 KB RAM geeinigt, Commodore wollte wieder auf
128 KB runter, aus Kostengründen. Doch Miner konnte sich durchsetzen und sah
eine Erweiterung auf 512 KB als Steckkarte vor. Mehr war nicht möglich, weil
die Spezialchips nur soviel adressieren konnten (als man sie konzipierte, waren
diese 512 KB unbezahlbar und unvorstellbar gewesen). Erst mit der Einführung
von FastRAM und dem ECS-Chipset
konnte diese Grenze viel später überschritten werden. In den ursprünglichen
Entwürfen waren ein Steckplatz für Spiele-Module, ein internes 300-Baud-Modem
und ein Anschluß für eine Laser Disk (für Video-Anwendungen) vorgesehen,
alles dieses hat Commodore weggestrichen. So hatte der Amiga mit dem ersten Entwürfen
bald nicht mehr vieles gemeinsam: Eigentlich nur die Grafik- und
Soundeigenschaften, alles andere wurde nach und nach, teilweise mehrmals, verändert.
Aber es gab noch andere Probleme. Tramiel sann auf Rache. Aus der Firma geworfen
und den Amiga nicht bekommen, gab er seinen Chefentwickler Shivaz Shivji (der
den C64 entworfen hatte und Trameil nach Atari gefolgt war) den Auftrag, einen
16-Bitter auf Basis des Motorola 68000 zu bauen. Zusätzlich klagte er gegen
Amiga Inc., Jay Miner hätte Patente aus dessen Zeit bei Atari verletzt, als er
die Chips des Amigas entwarf. CBM konterte mit Gegenklage: Atari habe massenhaft
Commodore-Entwickler abgeworben. Der Atari-Amiga-Kampf begann, der sich noch
lange Jahre zwischen beiden Unternehmen fortentwickeln sollte und auch die
Anwender zu teilweise erbitterten Gegner machen sollte. Das Ganze artete zu
einem "Glaubenskrieg" aus, anstatt daß man sich gemeinsam gegen den
eigentlichen Konkurrenten PC gestellt hätte.
Commodore
pumpte sofort nach der Übernahme weiteres Geld in die Entwicklung. Die
Workstations der Software-Ingenieure, auf denen sie den Quellcode compilierten,
waren langsame SAGE-Minicomputer. Sie wurden durch schnelle SUN-Workstations
ersetzt. Und weitere Angestellte erschienen auf der Bildfläche, die
mitentwickeln sollten. Das alles verzögerte aber die Fertigstellung, so daß
man das Weihnachtsgeschäft 1984 verpaßte. Im Januar 1985 war wieder CES. Ein
Jahr nach der ersten öffentlichen Vorführung war der Amiga immer noch nicht
lieferbar! Dafür der rasend schnell entwickelte Atari ST! Ein Schock für CBM
und Amiga, Inc. Nun war man nur noch Zweiter im Wettlauf um den
16-Bit-Heimmarkt.
Nun unter dem Codenamen "Lorraine" entwickelt, nannte man den Amiga
intern "Rette-die-Firma-Maschine". Zwar hatte man die Hardware
serienreif, das Gehäuse und die Tastatur waren fertig, aber die System-Software
war immer noch nichts Rechtes. Commodore importierte Tim King von der britischen
Software-Schmiede Metacomco. Er hatte ein fertiges 16-Bit-Betriebssystem namens
TriPos geschrieben, das auf alle möglichen Plattformen portiert werden konnte.
Es entstand während seiner Studienzeit 1976 und wurde bis 1984 auf verschiedene
Großrechner portiert. Die Anpassung an den Amiga soll nur drei Wochen gedauert
haben, dann war die Anbindung an die WorkBench (grafische Oberfläche) und die
CLI (Kommandozeileneingabe ähnlich des DOS-Prompt) fertig. King bestand auf
CLI. Zwar wollte CBM einen nur grafisch zu bedienenden Rechner wie den
Macintosh. Aber King sagte: "Löschen Sie mal mit einer grafischen Oberfläche
alle Dateien, die mit einem "p" anfangen. im CLI geben Sie DEL p.?#
ein, auf der WorkBench klicken Sie hundertmal." (Anmerkung: im Gegensatz zu
CP/M und MS-DOS nutzt der Amiga nicht die zwei Platzhalter "*" und
"?", sondern nur "?". Das "#" hinter dem
"?" sagt aus, daß das "?" unendlich oft wiederholt wird.)
Allerdings war die Metacomco-DOS-Anpassung ohne das Wissen der
Hardware-Entwickler in Kalifornien gemacht worden. Sie bekamen das fertige
Ergebnis präsentiert und mußten nun wieder einmal ihre Grafik-Schnittstellen
anpassen. Das Verhältnis Los Gatos (Amiga Inc.) und West Chester
(CBM-Hauptsitz) wurde immer schlechter. Die Amiga-Designer fühlen sich immer
mehr als Befehlsempfänger, deren "Kind" Amiga von Marketingmenschen,
die von Technik keine Ahnung haben, umgestaltet wurde.
Das Aussehen der WorkBench (blauer Hintergrund, weiße Schrift, rote Rahmen und
Mauszeiger, usw.) wurde auf NTSC ausgelegt. Dieses Farbsystem ist im Gegensatz
zum europäischen PAL-System nicht sehr farbstabil; es kann vorkommen, daß die
Farben "kippen", Filmschauspieler plötzlich grüne Gesichter bekommen
usw. Die Entwickler fuhren zu einem Second-Hand-Electronikladen und kauften die
ältesten und kaputtesten Fernseher, die sie bekommen konnten. Auf diesen
Bildschirmen wurde solange herumexperimentiert, bis man die Farbkombination
fand, die auf allen gut und stabil zu erkennen war. Trotz aller Eile bekam man
die Systemsoftware nicht hundertprozentig fertig. So entschloß man sich zu
einem Trick: Der Serien-Amiga bekam nur ein winziges Boot-ROM, das nach einer
KickStart-Diskette verlangt. Ist diese geladen, kann die WorkBench von einer
zweiten Diskette nachgeladen werden. Der Speicher, in die das KickStart von
Diskette eingelesen wird, hat einen WORM (Write Once, Read Multiple) Status.
Durch TTL-Logik werden die Schreibleitungen der KickStart-RAM-Chips nach dem
Einlesen des KickStart dauerhaft und unwiederbringlich gesperrt. Selbst ein
Absturz des Rechners kann den Inhalt dieses RAMs nicht verändern, so daß nur
einmal pro Einschalten des Computers die Aufforderung zum Einlegen der
KickStart-Diskette erscheint. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene
KickStart-Versionen veröffentlicht, und beim späteren A500/A2000 liefen sie so
stabil, daß diese Rechner ein ROM bekommen konnten.
Kurz
vor der Veröffentlichung (nach Wochen und Monaten von Dauerschichten,
Nachtschichten, durchprogrammierten Wochenenden usw.) waren immer noch Fehler in
der Systemsoftware enthalten, die einen längeren Betrieb unmöglich machen.
Commodore entschloß sich dazu, den ausgelaugten Entwicklern einen viertägigen
Zwangsurlaub zu verpassen, damit sie sich erholen konnten, und anschließend mit
neuem Schwung die Fehler zu erkennen und zu beseitigen. Die Designer waren natürlich
nicht davon überzeugt, daß diese Maßnahme Erfolg hätte. So stellte CBM Wächter
ein, die verhindern, daß an den 4 Tagen gearbeitet wurde! Wer von den
Entwickler in das Gebäude wollte, weil er persönliche Dinge vergessen hatte,
wurde unter Begleitschutz eingelassen und streng überwacht, ob er nicht etwa
heimlich ein bißchen programmieren wollte.
Das Gehäuse zeigte eine Besonderheit. Auf der Innenseite des Deckels hatten
alle an der Entwicklung beteiligten Personen unterschrieben. Diese
Unterschriften wurden digitalisiert und in die entsprechende Kunstoff-Spritzgußform
eingearbeitet. So ist jeder Amiga wie ein Kunstwerk signiert. Einzigartig in der
Branche. Lediglich Apple erlaubte es sich, vom IIgs
eine Sonderserie aufzulegen, die der Hauptentwickler Steve Wozniak handsignierte
(etwa 1000 Exemplare, heute gesuchte Sammlerstücke).
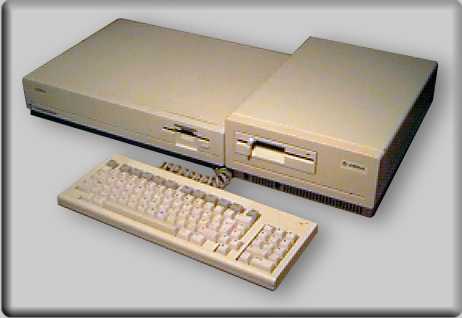 Vorgestellt
wurde der endlich fertige Computer am 23. 7. 1985. Nicht auf einer Messe,
sondern auf einer eigenen Veranstaltung, die nur den Amiga präsentierte. Im
Lincoln Center, New York, erlebte der Rechner seine erste Präsentation. Es gab
nur drei fertige Prototypen. Die letzen Arbeiten daran waren noch am Vortag
gelaufen. Die Entwickler hatten die Vorseriengeräte per Flugzeug von Los Gatos
(dem Amiga-Firmensitz) nach N.Y. transportiert. Damit ihnen nichts passierte,
hatte man pro Computer einen Sitzplatz gebucht, so daß ein Angestellter immer
neben einem Computer saß. Bis kurz vor Eröffnung wurde an den Präsentationen
und Hardware-Aufbauten gebastelt. So gab es gerade einmal fünf Genlocks (Geräte,
um den Amiga und ein externes Videosignal zu synchronisieren und das
Computerbild über das Fernsehbild zu legen). Drei davon worden benötigt und
die anderen waren als Reserve gedacht, falls eines ausfallen sollte.
Vorgestellt
wurde der endlich fertige Computer am 23. 7. 1985. Nicht auf einer Messe,
sondern auf einer eigenen Veranstaltung, die nur den Amiga präsentierte. Im
Lincoln Center, New York, erlebte der Rechner seine erste Präsentation. Es gab
nur drei fertige Prototypen. Die letzen Arbeiten daran waren noch am Vortag
gelaufen. Die Entwickler hatten die Vorseriengeräte per Flugzeug von Los Gatos
(dem Amiga-Firmensitz) nach N.Y. transportiert. Damit ihnen nichts passierte,
hatte man pro Computer einen Sitzplatz gebucht, so daß ein Angestellter immer
neben einem Computer saß. Bis kurz vor Eröffnung wurde an den Präsentationen
und Hardware-Aufbauten gebastelt. So gab es gerade einmal fünf Genlocks (Geräte,
um den Amiga und ein externes Videosignal zu synchronisieren und das
Computerbild über das Fernsehbild zu legen). Drei davon worden benötigt und
die anderen waren als Reserve gedacht, falls eines ausfallen sollte.
Es war auch Prominenz eingeladen worden: Debby Harry (Sängerin der Pop-Gruppe
Blondie) und - Andy Warhol. Der sagte nicht einfach ein paar nette Sätze.
Sondern während Blondie sang, bearbeitete er in Echtzeit das Videobild, das
dann auf die große Leinwand projiziert wurde. Er war vom Ergebnis begeistert.
Noch auf der Vorstellung bestellte er für sein Atelier mehrere Geräte. Doch
ein Stück Software erzielte den größten Erfolg. Der "Transformer",
der per Software einen IBM-PC emulierte, ermöglichte es dem neuen System, auf
Tausende fertiger Programme zurückzugreifen. Der Autor, Bob Parieau (Vizepräsident
der Softwareabteilung), sagte, das Starten von z. B. Lotus 1-2-3 (damals die
Nummer 1 der Tabellenkalkulationen) würde auf einem Original-IBM genauso
langsam vor sich gehen.
Besucher und Journalisten waren einhellig begeistert. Eine Computerzeitschrift
meinte, daß das Ende der PCs, MACs und aller anderen Kisten gekommen wäre. Und
die neue Kiste war stark. Genau wie der Macintosh auf den schnellen Motorola
68000-Prozessor basierend, standen der CPU aber drei schnelle Custom-Chips zur
Seite, die ihn wesentlich schneller als den Mac machten. Als erster Heimcomputer
der Welt beherrschte er Multitasking, also die Abarbeitung mehrere Programme
gleichzeitig. Und seine Grafik- und Soundfähigkeiten waren sensationell:
Vierstimmiger Stereo-Digitalsound (basierend auf 8-Bit-Samples), maximal 4096
Farben, bei ca 640 mal 400 Pixel diese GLEICHZEITIG, mehrere virtuelle
Bildschirme, die der Anwender hintereinanderlegen konnte (jeder dieser Screens
kann eine andere Auflösung und Farbtiefe haben!), eine grafische Oberfläche,
die aber trotzdem (wer es denn will...) per Command Line Interface (CLI) zu
bedienen ist, Sprachausgabe, das alles war sensationell.
Leider war der Anfangspreis von etwa 7000 DM mit Maus, Tastatur und Farbmonitor
zu hoch für den Heimmarkt. Und wer ihn kaufen wollte, mußte ewig warten. Erst
ab September wurde ausgeliefert. Zuerst gab es Produktionsprobleme, dann konnte
man nicht genug herstellen. Zusätzlich hatte Commodore Finanzprobleme. Die
Entwicklung des Amiga und die Flops der 8-Bit-Rechner (Plus4, C16, C116 ,C128,
C128D, die alle die Entwicklungskosten nicht hereinholten) hatten das Polster
aufgezehrt. Lediglich der Dauerbrenner C64 hielt den Konzern am Leben. So war
kein Geld für Anzeigenkampagnen für den Amiga verfügbar, zusätzlich
kursierten Gerüchte über einen drohenden Konkurs, was potentielle Käufer auch
nicht ermutigte. Zusätzlich peilte man mit dem Gerät eine Zielgruppe an, die
IBM-PCs und Apples kaufte: Als Bürocomputer. Jedoch gab es keine Software, die
diesen Schichten den Amiga schmackhaft gemacht hätte.
Im
November 1985 veröffentlichte man die Spezifikation des Zorro-I-Busses
(Erweiterungsschnittstelle des Amiga). Im Januar 1986 die des Zorro-II-Bus.
Sofort kursierten Gerüchte über neue Amigas mit Motorola 68020-CPU und
eingebauter Festplatte. Namen wie Amiga III, Amiga IV oder Amiga V wurden
genannt, ein Projekt "Ranger" sollte entwickelt werden und so weiter
und so fort. Dementis hier, Dementis da, Dementis dort. "Ranger" sei
nur ein Sammelbegriff für neuentwickelte Amigas. Die ersten Mitglieder des
Los-Gatos-Teams von Amiga Inc. verließen damals Commodore, weil sie die Pläne
für neuere, bessere schnellere Amigas nicht durchsetzen konnten. Das Konzept
des verkauften Gerätes stammte ja aus dem Jahre 1982/1983, es war eigentlich längst
veraltet.
Im Februar 1986 gab es endlich europäische Amigas mit PAL statt
NTSC-Video-Ausgang und deutscher Tastatur (naja, es befanden sich Aufkleber mit
den deutschen Umlauten auf einer US-Tastatur). Auch hier wieder Lieferverzögerungen
und endlose Wartezeiten. März 86 fand die offizielle Premiere in Frankfurt /
Main in der alten Oper statt. Gleichzeitig verhandelte man mit der UdSSR. Doch
bedingt durch die COCOM-Beschränkungen (amerikanisches Exportverbot auf
"bessere" Computersysteme mit 16-Bit-CPU) mußte man davon Abstand
nehmen.
Im März
1986 ersetzte man Smith durch Thomas J. Rattigan, den Gould bereits April 1985
eingestellt hatte, um Smith langfristig abzulösen. Smith wurde nach dem Wechsel
als Direktor weiterbeschäftigt. Rattigans Aufgabe war klar: Kosten senken,
Commodores Position am Markt verbessern, und den Konzern wieder auf stabilen
Kurs bringen. Noch einmal wurden Entlassungen ausgesprochen, drei Fertigungsstätten
in fünf Monaten geschlossen und alles besser organisiert. Eine neue Struktur
wurde im Management eingeführt, um verdeckte Kosten schneller erkennen zu können,
und Ladenhüter sowie Fehlentwicklungen eher auszumerzen. Der C64 wurde
weiterhin erfolgreich für 150 Dollar und sein Nachfolger, der C64-II für 300
Dollar verkauft, so daß Geld in die Kassen strömte. Rattigans Pläne waren
erfolgreich. Im März 1987 hatte CBM alle Schulden bezahlt und konnte wieder
einen Gewinn von 22 Millionen Dollar für das letzte Quartal 1986 vorweisen. Und
man hatte 46 Millionen Dollar Kapital ansammeln können, mehr als im bisher
besten Jahr, 1983.
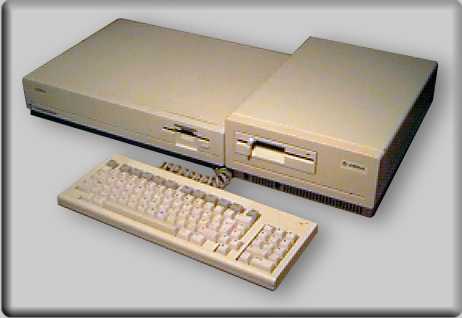 Der Beiwagen löste im Sommer 1986 die Software-IBM-Emulation ab. Es handelt
sich um einen kompletten PC-kompatiblen Computer mit 8088-CPU, 256 KB RAM (auf
512 KB aufrüstbar), Floppycontroller und 360-KB-2,25-Zoll-Laufwerk (extern
Amiga-Laufwerke als DOS-Laufwerk mit 720 KB anschließbar) sowie einer
Adapterplatine (Janus, der Zweiköpfige) in eigenem Gehäuse. Weil man diese
Kiste neben den Amiga stellt, nannten die Entwickler (übrigens das erste
Amiga-Produkt aus Braunschweig) sie Beiwagen. Es waren wohl wilde MotoBiker...
Der Sidecar nutzt zur Tastatur-Eingabe und Bildschirm-Ausgabe die
Amiga-Hardware, die eigentlichen Programme laufen auf dem PC-Board. Der Amiga
mit Sidecar war der erste Multi-Prozessing-Computer der Welt. Man konnte auf dem
Amiga ein Bild rendern und auf dem Sidecar eine Datenbank reorganisieren, ohne
daß sich die beiden Geräte stören.
Der Beiwagen löste im Sommer 1986 die Software-IBM-Emulation ab. Es handelt
sich um einen kompletten PC-kompatiblen Computer mit 8088-CPU, 256 KB RAM (auf
512 KB aufrüstbar), Floppycontroller und 360-KB-2,25-Zoll-Laufwerk (extern
Amiga-Laufwerke als DOS-Laufwerk mit 720 KB anschließbar) sowie einer
Adapterplatine (Janus, der Zweiköpfige) in eigenem Gehäuse. Weil man diese
Kiste neben den Amiga stellt, nannten die Entwickler (übrigens das erste
Amiga-Produkt aus Braunschweig) sie Beiwagen. Es waren wohl wilde MotoBiker...
Der Sidecar nutzt zur Tastatur-Eingabe und Bildschirm-Ausgabe die
Amiga-Hardware, die eigentlichen Programme laufen auf dem PC-Board. Der Amiga
mit Sidecar war der erste Multi-Prozessing-Computer der Welt. Man konnte auf dem
Amiga ein Bild rendern und auf dem Sidecar eine Datenbank reorganisieren, ohne
daß sich die beiden Geräte stören.
Das Gehäuse ist fast so groß, wie das des A1000, zwar schmaler, aber dicker
und tiefer. Im Inneren befinden sich zwei Platinen, die untere ist ein
waschechter PC-Nachbau mit CPU, RAM, ROM, XT-Slots, DIP-Switches,
Floppycontroller, usw. Die obere Platine ist eine Bridgekarte und verbindet den
Amiga (als Zorro-I-Karte) mit dem PC. Der PC "denkt", er habe eine
richtige Grafikkarte bzw. eine eigene Tastatur, jedoch werden ihm lediglich die
vom Amiga kommenden Signale als Tastaturersatz vorgespielt, und die Grafikdaten
werden aus dem GrafikRAM des PCs an den Amiga übergeben, der sie in einem
Fenster (bzw. einem eigenen Screen) anzeigt. Greift der PC auf "seine"
serielle bzw. parallele Schnittstelle zu, werden sie ebenfalls auf die des Amiga
umgelenkt. Umständliches Umstöpseln der Geräte wie Monitor, Drucker, usw.
entfällt also. Und sowohl Amiga als auch PC laufen mit voller Geschwindigkeit,
ohne sich gegenseitig zu bremsen.
Ursprünglich war vom Multitasking nichts zu spüren. Die Deutschen hatten zwar
die geniale Hardware hinbekommen, aber die Ein- und Ausgabe-Software war
miserabel. Das Amigaprogramm verbrauchte 100% Rechenzeit, nur um die
Bildschirm-Ausgaben des PCs in ein Amiga-Fenster umzulenken! So flog man aus den
USA R. J. Mical ein. Der hatte zwar eigentlich schon gekündigt, ließ sich aber
überreden, für harte Dollars eine bessere Software zu schreiben. Er
entwickelte ein multitaskingfähigen Kernel, der als echter Amiga-Task nur ab
und zu einmal die Tastatureingaben des Amiga an den PC weiterreicht und nur bei
Bildschirm-Änderungen des PCs das Amiga-Fenster aktualisiert. Er nannte seine
Routinen Zaphod (nach dem zweiköpfigen Meisterdieb aus "Per Anhalter durch
die Galaxis" von Douglas Adams). Diese Routinen waren so gut, daß sie fast
unverändert für die späteren Brückenkarten des Amiga 2000 (8086 und
286-Prozessorkarten für den Amiga
2000) übernommen wurden.
In Micals Routinen gabt es auch die Möglichkeit, vom Amiga aus auf die
Laufwerke des PCs zuzugreifen! (PC0 und PC1) Somit stand einem Datenaustausch
nichts im Wege. Sollte man den PC mit einer Festplatte ausgestattet haben,
konnte man diese auch Lesen und Schreiben. Jedoch hatten alle diese Vorteile
einen erheblichen Nachteil: den Preis. Circa 2000 DM waren für einen
PC-Kompatiblen Computer damals recht hoch, für dieses Geld bekam man einen
Fernostnachbau mit 640 KB, eigener Tastatur und doppelter Geschwindigkeit. So
war die verkaufte Stückzahl nicht sehr hoch.
1986
schien der Amiga
am Ende. Er verkaufte sich nur in Nischenbereichen (seine Grafik-Fähigkeiten
machten ihn in Fernsehstudios unersetzlich). Für größere Verkaufszahlen
reichte das aber nicht aus. Sommer 1986 verdichteten sich die Gerüchte um eine
neue Amiga-Generation. Man redete von neuen Sonderchips, die Jay
Miner (der Commodore inzwischen schwer enttäuscht verlassen hatte) noch
entwickelt hätte. 2 MB Video-RAM adressierbar, mehr Farben, schnellerer
Bildaufbau waren die angeblichen Features. Jay sagte in einem Interview, CBM
wolle den in der Fertigung zu teuren A1000 auslaufen lassen und durch einen
Tastaturcomputer (also CPU, Floppy und Tastatur in einem Gehäuse) ersetzen.
Damals war der Atari
ST erfolgreicher als der Amiga, weil er preiswerter war. Commodore dachte
aber, es läge daran, weil der Amiga so professionell aussähe und wollte einen
Computer bauen, der den C64
ablösen sollte. (Bei Atari gab es hingegen Entwicklungen, den ST dem Amiga ähnlicher
zu machen mit abgesetzter Tastatur und Desktop-Gehäuse: die Mega-ST-Serie).
Miner war der Ansicht, den A1000
innerhalb eines halben Jahres neu zu designen, die besseren Chips zu
integrieren, und so den Fertigungspreis (und damit den Verkaufspreis) zu senken.
CBM wollte das auch, machte es aber lieber selber. Das Management entschied, die
Amiga-Linie zu splitten: in eine Heimversion und eine Profiversion, ähnlich wie
früher der C64
die Heimmaschine und die 8000
die Profirechner waren. Wieder wurde der Heimcomputer in den USA und der
Profirechner in Braunschweig entwickelt. Es enstanden Geräte, die mit dem
Ur-Amiga (den man ab jetzt Amiga 1000 nannte) eigentlich nur das Konzept und
wenige Chips gemeinsam hatten, ansonsten wurden sie neu entwickelt. Von den
Entwicklern des A1000 war fast niemand mehr daran beteiligt.

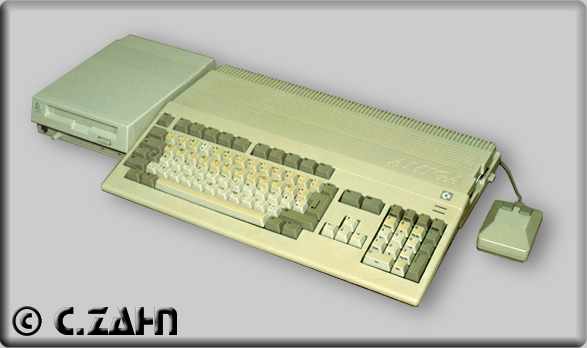 Doch es dauerte recht lange. In Braunschweig
hatte man mit dem Sidecar
Erfahrungen mit der Verbindung des Amigas mit dem PC gewonnen und wollte den neu
zu entwickelnden Rechner gleich mit Steckplätzen und optionaler PC-Karte
versehen. So bekam der A2000 drei Zorro-II Steckplätze für Amiga-Karten, einen Videosteckplatz für
Genlocks und FlickerFixer (um das augenschädigende Interlace-Flimmern zu
beseitigen), einen Prozessorslot für optionale schnellere CPUs (z. B. den neuen
Motorola 68030 mit 25 MHz) und schließlich drei AT-Steckplätze, wie sie in den
normalen Industrie-PCs von IBM auch eingebaut waren.
Doch es dauerte recht lange. In Braunschweig
hatte man mit dem Sidecar
Erfahrungen mit der Verbindung des Amigas mit dem PC gewonnen und wollte den neu
zu entwickelnden Rechner gleich mit Steckplätzen und optionaler PC-Karte
versehen. So bekam der A2000 drei Zorro-II Steckplätze für Amiga-Karten, einen Videosteckplatz für
Genlocks und FlickerFixer (um das augenschädigende Interlace-Flimmern zu
beseitigen), einen Prozessorslot für optionale schnellere CPUs (z. B. den neuen
Motorola 68030 mit 25 MHz) und schließlich drei AT-Steckplätze, wie sie in den
normalen Industrie-PCs von IBM auch eingebaut waren.
Auf der CES Januar 1987 wurde der A2000 gemeinsam mit der amerikanischen
Entwicklung, dem A500,
vorgestellt. Das war der Tastatur-Computer, der technisch dem A2000 völlig
gleicht, jedoch nur einen Zorro-II-Slot hat (die Karten konnten nur extern links
eingeschoben werden und brauchten ein eigenes Gehäuse). Beide Rechner hatten
wieder nur 512 KB RAM, das aber auf maximal 1 MB ChipRAM und 8 MB FastRAM (auf
das der Prozessor allein zugreift, und deswegen nicht durch die Sonderchips
ausgebremst wird. Hat ein Amiga FastRAM, wird er um ca. 25% schneller.)
erweitert werden konnte. Nur: die verbesserten Chips von Jay Miner waren NICHT
eingebaut! Eine richtige Verbesserung stellten beide Computer nicht dar, sie
waren eigentlich eine kostenreduzierte Version in einem anderen Gehäuse.
Der A500 war als Einsteigermaschine gedacht, die das Marktsegment des C64
bedienen sollte, und mit dem A2000 (der wie ein IBM-Computer aussieht und
genauso erweiterbar ist) hoffte man, endlich im Büromarkt an die früheren
Erfolger der CBM 4000
und 8000 anknüpfen zu können.
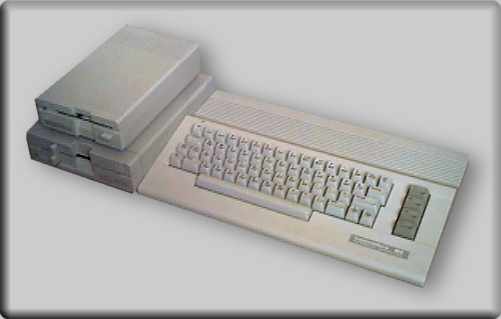 1986
wurde der C64
geliftet. Technisch identisch, bekam er ein moderneres Gehäuse und sah jetzt
aus wie der kleine Bruder des C128. Dazu passend wurde auch die Floppy 1541
modernisiert. Sie sind jedoch weder schneller noch besser als ihre Vorgänger,
dafür aber fast 100% kompatibel.
1986
wurde der C64
geliftet. Technisch identisch, bekam er ein moderneres Gehäuse und sah jetzt
aus wie der kleine Bruder des C128. Dazu passend wurde auch die Floppy 1541
modernisiert. Sie sind jedoch weder schneller noch besser als ihre Vorgänger,
dafür aber fast 100% kompatibel.
Trotz moderner Technik (viele Bauteile wurden zu höherintegrierten zusammengefaßt,
so benötigt man statt 8 RAM-Chips nur noch zwei) bleibt er eigentlich unverändert.
Nur Digi-Sounds (die den Soundchip mißbrauchen, um gesampelte Sounds
abzuspielen) hören sich auf dem neuen Computer wegen des geänderten Soundchips
"flacher" an. (Kurze Erklärung: gesampelte Stücke werden abgespeilt,
in dem die Software einen Ton in rascher Folge aus und wieder einschaltet. Die
dabei entstehenden "Knackser" ergeben dann den Klangeindruck eines
Samples. Da der C64 nur bis ca. 6 KHz "knacksen" kann, ist die
Tonqualität eher bescheiden und erinnert an eine schlechte Telefonverbindung.
Im C64-II funktioniert der Trick mit dem "Knacksen" nicht so richtig,
weil die Ingenieure beim neuen Soundchip diesen "Knackser-Fehler", der
ja eigentlich eine Tonverschlechterung bei normalen Tönen darstellt, beseitigt
haben. Folge: Das "Knacksen" ist erheblich leiser, Digi-Sounds sind
kaum hörbar. Weitere Änderung: da die neue Platine keine negative
Versorgungsspannung benötigt, fiel der entsprechende Teil der
Spannungsaufbereitung weg. Deswegen liegen aber auch keine 9 Volt
Wechselspannung mehr auf der Platine an und stehen somit am Userport nicht mehr
zur Verfügung. So manche externe Erweiterung läuft am C64-II nur mit extra
Netzteil. Und weil die Platine vollkommen überarbeitet wurde, das Gehäuse
insgesamt kleiner und flacher ist, passen fast alle internen Erweiterungen des
C64 nicht, so mußte die Zubehörindustrie die beliebten Floppyspeeder u. ä.
neu designen.
Die alte C64-Hardware (von den Anwendern liebevoll "Brotkasten" wegen
der rundlichen Form genannt) wurde zu reduzierten Preisen ausverkauft.
Am 22
April 1987 wurde Rattigan
von Irving Gould ersetzt. Die Gründe für den Wechsel sind unklar, schaffte es
Rattigan doch, CBM aus der Krise herauszuführen und im letzen Quartal 86 wieder
28 Millionen Dollar Gewinn einzufahren. Wahrscheinlich waren es persönliche
Konflikte zwischen Gould und Rattigan. Gould war wohl neidisch, weil der Erfolg
dem jüngeren Rattigan zugeschrieben wurde, und nicht dem seit 20 Jahren in der
Firma steckenden Senior. Gould begann eine dritte Entlassungswelle. Von 4700 auf
3100 Angestellte sank die Zahl der Beschäftigten, die Hälfte der
nordamerikanischen Zentrale mußte gehen und fünf Fertigungsstätten wurden
geschlossen.
Der Amiga
erreichte (vielleicht, weil man so wenig Werbung machte) erst im Jahre 1989 die
1-Million-Grenze. Anders als das Zugpferd, dem C64,
war der Amiga kein Selbstläufer, den man nur herzustellen und zu verkaufen mußte.
Die ersten Entwickler von Soft- und Hardware begannen bereits, sich enttäuscht
aus dem Amiga-Markt zurückzuziehen und für andere Systeme (PC und Macintosh)
zu entwickeln. Außer Gerüchten lieferte man weder neue Hardware noch wurde das
Betriebssystem signifikant verbessert.
Das einzige, was man neu vorstellte, war der Amiga 2500. In einem normalen A2000-Gehäuse
steckte ein unverändertes A2000-Motherboard. Lediglich steckte man zusätzliche
Komponenten mit hinein. Der A2500AT hatte die 286-Karte serienmäßig, der
A2000UX eine Beschleunigerkarte mit 68020-CPU sowie FastRAM und
100-MB-Festplatte. Also nichts neues, sondern nur Kombinationen von bereits
vorhandener Hardware. Sowohl Zeitschriften als auch die User waren entsprechend
enttäuscht.
Auch
Commodore-Manager erkannten (neben so manch anderer, später ebenso erfolglosen
Firma, wie z. B. Epson, Atari,
Tandy usw.), daß der Markt nach PC-kompatiblen Geräten verlangte. So wollte
auch CBM PC-Nachbauten herstellen. Doch anders als andere Anbieter kaufte man
nicht Teile in Fernost, um sie dort zusammenbauen zu lassen, und dann lediglich
Commodore draufkleben zu können. In Braunschweig wurde ab 1985 eine ganze
PC-Familie entwickelt. Das Gehäuse ähnlich dem Amiga
2000, mit Prozessoren vom 8088 bis (zuletzt) 80486. Und alles war "Made
by Commodore": das Motherboard, die Grafikkarte (ein neuer Grafikstandard
wurde entwickelt: AGA, kompatibel zu nichts auf der Welt), das Netzteil, eben
alles. So waren CBM-PCs teurer als gleichgute und gleichschnelle Billigangebote
aus Fernost; das bewog nicht viele Käufer, den Commodore-PC zu erwerben. So
richtig erfolgreich war die PC-Linie nur in Deutschland. Hier hatte CBM noch
seit den 8000ern den Rufe eines Bürocomputerherstellers. Anders in den USA.
Hier lag der geringe Absatz vor allem am Image des Spielecomputerherstellers.
Der C64 und der Amiga machten das Geschäft mit den Bürokunden unmöglich.
Manche Geräte verkauften sich so schlecht, daß man nicht einmal die
Entwicklungskosten hereinbekam. Neben der Erfolglosigkeit hatte der CBM-PC noch
einen Nachteil: Es sah so aus, als ob man selber nicht so recht an den Amiga
glauben wollte. Nicht gerade imageverbessernd. Das Ende der PC-Produktion 1992
kam da schon zu spät, zu viel Schaden war angerichtet.
Ab
1986 entwickelte eine damals kleine Softwareschmiede in Kalifornien, Berkeley
Softworks, eine grafische Benutzeroberfläche für den C64.
Die Version 1.0 war eigentlich nur eine Art Dateimanager, Programme wurden
mittels Maus gestartet, nach deren Beendigung war man wieder im GEOS (Grafical
Environment Operation System). Erst die Version 1.5, die auch Commodore dem neu
umgestalteten C64-II
kostenlos beilegte, konnte grafische Programme ausführen. Zuerst war lieferbar
GEO-Write, GEO-Calc, GEO-Draw, die dem C64 endlich skalierbare Zeichensätze,
systemweiten Druckertreiber usw. ermöglichten. Leider ist ein 8-Bit-Computer
unter dieser Oberfläche recht langsam und die Floppyladezeiten fallen noch stärker
ins Gewicht. Trotzdem war GEOS ein großer Erfolg, weitere Versionen (bis V3.0)
wurden entwickelt, unter anderem auch eine für den C128,
mit der man dank höherer Grafikauflösung und doppelter Arbeitsgeschwindigkeit
doch recht gut arbeiten konnte.
Berkeley Softworks portierte GEOS auch auf IBM-Kompatible; leider wurde es
ebenso wie PC-GEM von Digital Research durch Windows 3.0 überflüssig.
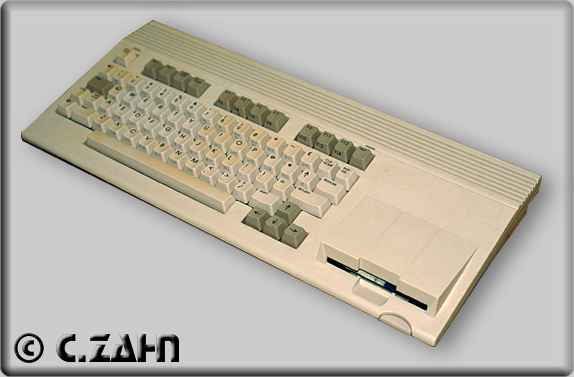 "Bitte?
C65? Wir kennen ja viel von Commodore. Aber ein C65?"
"Bitte?
C65? Wir kennen ja viel von Commodore. Aber ein C65?"
Das hört man oft. Auch bei C64
und/oder Amiga-Spezialisten,
die diese Rechner besser als die Entwickler kennen. Der C65 ist wohl das
unbekannteste Gerät, das man in West Chester je entwickelt und zur Serienreife
gebracht hat, inklusive fertigen Formen für das Gehäuse, Tastatur von
Fremdanbietern, spezielle Floppy (1581-kompatibel)
usw. Es sollte der Nachfolger des C64 werden. Mit Stereo-Sound à la Amiga, 4096
Farben, bis 800 x 600 Bildpunkte, 800-KB-Floppy (3,5 Zoll) im Computer
eingebaut, internationale Umlaute, bis 8 MB Speicher usw. sollte er sowohl die
alten C64-Programme "fahren" können (in der Originalgeschwindigkeit)
als auch mit seinem 8-Bit-Prozessor (von MOS angepaßter 6502, der bis zu 8 MB
adressieren kann) und 3,54 MHz Takt eine neue Ära einleiten.
Doch bei der Vorstellung 1991 an die Marketingstrategen wurde festgestellt, daß
der C65 nur den gerade gut gehenden A500-Markt
schädigen könnte, da Umsteiger, denen die Leistung des "alten
Zugpferds" C64
nicht mehr ausreichte, oftmals der Marke treu blieben und zum Bruder aus
gleichem Hause wechselten. Und man erkannte (wohl in einem guten Moment des
Marketings), daß die Einführung einer zweiten, nicht-PC-kompatiblen
Computerlinie immens teuer und risikoreich sein mußte.
Also wurde der C65 gestoppt. Als CBM 1993 Geldsorgen bekam, verkaufte man sowohl
die fertigen Prototypen als auch noch nicht montierte Platinen, Floppys und Gehäuse.
Zum ersten Mal konnte man den C65 (auch als C64DX bezeichnet) kaufen. Vor allem
Sammler und Commodore-Begeisterte griffen zu. Einige Exemplare schafften per
Direktimport auch den Weg in die USA und Australien. Heute kursieren etwa 200 Geräte unter
Sammlern hin und her, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann, da es
außer Demos und handverlesener PD nichts an Software gibt.
Seit
langen, zu langen Jahren gab es keine Neuigkeiten von Commodore. K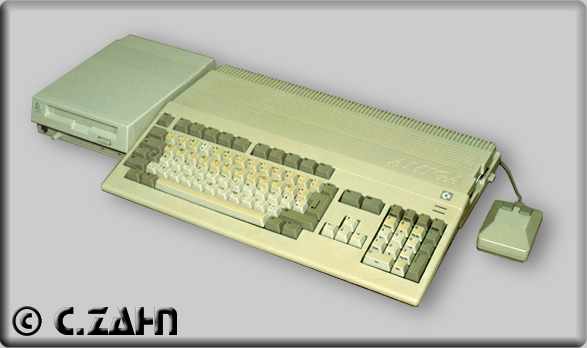 eine
wirklich neuen Geräte, keine neue Systemsoftware, nichts, was von Bedeutung wäre.
Außer Gerüchten, die schnellstens dementiert wurden, stagnierte Commodore. Der
Marktanteil des Amigas fiel, obwohl er sowieso nie sehr hoch war. Irving Gould
stellte wieder einmal einen neuen Topmanager ein, der durchgreifen sollte: Harry
Copperfield (trotz des Namens war er kein Zauberer...), der 20 Jahre bei IBM und
2 Jahre als Vertriebsleiter von Apple gedient hatte. Auf einer Konferenz, zu der
man etliche amerikanische Entwickler geladen hatte, präsentierte er seine neuen
Unternehmensziele: Verbesserung des Konzern-Images, Wechsel der Werbeagentur,
den Amiga als Schwerpunkt der Produktion und Vermarktung (dies implizierte den
Abschied von den PC/AT-Nachbauten sowie den leisen, langsamen Tod des C64),
den Vertrieb verbessern (bessere und schnellere Lieferbarkeit der Produkte statt
langer Wartezeiten), neue Zielmärkte (Schulen, Hochschulen, Regierung; dort war
Apple
traditionsgemäß Marktführer), mehr Kundenorientierung. Zitat:
"Zufriedene Kunden kaufen wieder, unzufriedene auch - aber bei der
Konkurrenz." Weiterhin stellte er weitere neue Manager vor, alles von Apple
abgeworbene, erfahrene Leute. Und - das war noch nie da - er fragte die
anwesenden Entwickler, was sie vom Amiga hielten, was man verbessern könnte,
wie man mehr Marktanteile erobern könne, kurz gesagt, die Entwickler bekamen
nicht wie früher, Gerüchte vorgesetzt, sondern sollten aktiv am Amiga-Konzept
mitarbeiten.
eine
wirklich neuen Geräte, keine neue Systemsoftware, nichts, was von Bedeutung wäre.
Außer Gerüchten, die schnellstens dementiert wurden, stagnierte Commodore. Der
Marktanteil des Amigas fiel, obwohl er sowieso nie sehr hoch war. Irving Gould
stellte wieder einmal einen neuen Topmanager ein, der durchgreifen sollte: Harry
Copperfield (trotz des Namens war er kein Zauberer...), der 20 Jahre bei IBM und
2 Jahre als Vertriebsleiter von Apple gedient hatte. Auf einer Konferenz, zu der
man etliche amerikanische Entwickler geladen hatte, präsentierte er seine neuen
Unternehmensziele: Verbesserung des Konzern-Images, Wechsel der Werbeagentur,
den Amiga als Schwerpunkt der Produktion und Vermarktung (dies implizierte den
Abschied von den PC/AT-Nachbauten sowie den leisen, langsamen Tod des C64),
den Vertrieb verbessern (bessere und schnellere Lieferbarkeit der Produkte statt
langer Wartezeiten), neue Zielmärkte (Schulen, Hochschulen, Regierung; dort war
Apple
traditionsgemäß Marktführer), mehr Kundenorientierung. Zitat:
"Zufriedene Kunden kaufen wieder, unzufriedene auch - aber bei der
Konkurrenz." Weiterhin stellte er weitere neue Manager vor, alles von Apple
abgeworbene, erfahrene Leute. Und - das war noch nie da - er fragte die
anwesenden Entwickler, was sie vom Amiga hielten, was man verbessern könnte,
wie man mehr Marktanteile erobern könne, kurz gesagt, die Entwickler bekamen
nicht wie früher, Gerüchte vorgesetzt, sondern sollten aktiv am Amiga-Konzept
mitarbeiten.
Copperfield zauberte (das Wortspiel muß sein...) in kurzer Zeit neue Produkte
hervor. Es waren Entwicklungen, die seine Vorgänger angefangen und wieder
gestoppt, oder gar fertig entwickelt, liegengelassen hatten. Darunter: eine
Motorola-68030-CPU-Karte für den A2000, eine Amiga-Grafikkarte mit True Color,
ein stark beschleunigter Festplattencontroller (A2091), eine serielle
Schnittstellenkarte (statt 19.200 Baud mit zeitgemäßen 115.000 Baud),
Netzwerkkarten, und - vielleicht das wichtigste - ein verbessertes ChipSet für
A500 und A2000. Beide Geräte bekamen neue Motherboards mit dem ECS-Chipset
verpaßt, das mehr Farben darstellen kann und bis 2 MB Adressraum beherrscht
(statt 512 KB). Und: Es wurde offiziell bestätigt, daß man am A3000 arbeite!
Oktober
1989 wurde der A500 (mit 1 MB RAM serienmäßig) in ganz Amerika wieder-eingeführt.
George Lucas hatte die neuen Werbefilme produziert, die auf der "Amiga
Relaunch" erstmals vorgestellt wurden. Copperfield sagte auf dieser
Veranstaltung: "Commodore hat das wohl bestgehütete Geheimnis der
Computerbranche: eine Produktreihe mit dem Namen Amiga." Er verkündete, daß
von diesem Geheimnis bereits über 1 Million Geräte verkauft worden waren
(eigentlich eine beschämende Tatsache, das sind 200.000 Geräte pro Jahr in
einem Zeitraum von 5 Jahren).
Trotzdem brachte der Werbeaufwand nicht den gewünschten Erfolg. Zwar stieg der
Verkauf des Amiga, aber eigentlich nur in Großbritannien stark: Innerhalb 6
Wochen 100.000 Amiga 500! Das war wohl eine Folge der dortigen Kampagne, weil es
zum Rechner Software im Wert von umgerechnet 500 DM dazugab. Zusätzlich war in
England ein Teil der Rechner an Besitzer des BBC-Micro
gegangen. Dieser Computer war Anfang der Achtziger Begleitmaschine zu einer
Fernsehserie der BBC gewesen, die dem Zuschauer das "Computern"
beibrachte. Für den Amiga gab es einen Emulator, der besser und schneller als
das Original war, so konnte diese Kundschaft ihre alte, teils
selbstprogrammierte, Software auf den Amiga mitnehmen.
Trotz allem gerüchteküchelte es bald wieder: Man munkelte um einen tragbaren
Amiga. Prototypen seien fertig (im Gehäuse eines SX-64
ein A500-Board, eine kleine Festplatte LCD-Display und 68020-CPU). Daraus wurde
aber nichts, das Projekt eingestellt.
Im März
1990 wurde endlich ein neuartiges Produkt vorgestellt: Amiga
CDTV. Die Abkürzung stand zuerst für "Compact Disk Television",
bald aber zu "Commodore Dynamics Total Vision" umgemünzt. Zwar wurde
die Markteinführung auf 1991 gelegt, aber nur, um mehr Software zum
Verkaufsstart anbieten zu können. Jedoch ist das CDTV lediglich ein A500 mit 1
MB, CD-Laufwerk (Singlespeed) und CD-Abspielsoftware im ROM in einem schwarzen
Gehäuse, das von Größe und Formgebung zur heimischen Stereoanlage paßte. Es
ließ sich zwar zu einem "Richtigen" Amiga aufrüsten, doch erhöhte
sich der Grundpreis von ca. 1600 DM durch Zukauf von Floppy, Tastatur, Maus,
Monitor, usw. um über 1000 DM, so daß das Gerät einfach überteuert war.
Es gab zu wenig gute Anwendungen, die das Medium CD sinnvoll einsetzten, als daß
das CDTV ein Erfolg hätte werden können. Wer computern wollte, konnte sich für
etwa 1000 DM einen Amiga
500 hinstellen, zwar ohne CD, dafür aber mit tausenden Programmen.
Commodore plante aber auch den kommerziellen Einsatz als POI/POS-System (Point
of Information / Point of Sale) auf Messen, in Geschäften, in Museen, usw.
Leider hing CBM und dem Amiga der Ruf des Spielecomputers an, deswegen
wurde er in diesem Bereich nicht angenommen. Außerdem war 1990 noch zu früh für
Multimedia. Der Boom kam erst später. 1993 und 1994 wurde das CDTV als
Komplettpaket inklusive schwarzem Monitor für weniger als 1000 DM ausverkauft.
Das
CD-Laufwerk wurde auch für den "alten" A500
angeboten: als CD 570. So sollte die Verbreitung des Mediums CD-ROM auf dem
Amiga gefördert werden und den Produzenten von CDTV-CDs ein breiterer Markt eröffnet
werden. Leider halfen auch die Erweiterbarkeit des A570 nicht viel: Intern war
Platz für eine FastRam-Erweiterung sowie einen SCSI-Controller, um Festplatten
am A500 betreiben zu können. Doch war ein komplett aufgerüstetes A570 teurer
als eine entsprechende Lösung von Drittanbietern. Die Nomal-Amigaanwender
sprachen auf das neue Medium noch nicht an, der CD-Boom kam bekanntlich einige
Jahre danach.
Die im CDTV-System schlummernden Fähigkeiten wurden von kaum einer Software
ausgenutzt, so waren die veröffentlichten Titel meist nur um CD-Sound
aufgepeppte Versionen von normalen Amiga-Spielen oder Lexikons bzw.
Weltatlanten. Daß CDTV gleichzeitig Video-Animation und CD-Ton abspielen kann,
merkt man nur an einigen CDTV-Programmen.
Am 24
April 1990 wurde der A3000 in einer Gala vorgestellt. Sie war nicht so imposant
wie die von 1985, aber die Anwesenden waren trotzdem begeistert. Der Rechner war
stark, daran war kein Zweifel. Mit 68030-Prozessor, 25 MHz Takt, dem neuen ECS-Chipset,
HD-Floppys,
komplett durchgehende 32-Bit-Architektur, neue Systemsoftware (endlich KickStart
2.0!) gab es einen enormen Leistungsschub für die Amigagemeinde. Copperfield
sagte, daß der A3000 das einzige echte Multimediasystem sei. Apple wolle
Multimedia mit seinen Mac II, könne sein Versprechen aber nicht halten. Ein
Amiga sei bereits seit 1985 multimediafähig.
Eine Version mit Unix wurde als A3000UX bezeichnet. An dieser Maschine zeigte
sogar der WorkStation-Hersteller SUN
Interesse. Man wollte den Amiga als kleines Begleitsystem für die neuesten,
recht teuren SPARC-Stations unter dem Namen SUN als OEM-Gerät vermarkten. Das
Management von Commodore war sich dazu zu fein. SUN kaufte in Fernost.
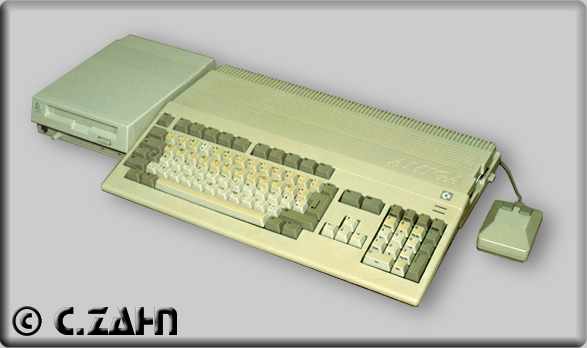 Dem
Amiga ging es ausnahmsweise gut. Er verkaufte sich passabel, die Kunden waren
wegen prompter Lieferung recht zufrieden, die Entwickler hatten Anteil am
Geschehen, da machte das Management einen Riesenfehler. Der Amiga
500 wurde durch den Amiga 500plus ersetzt. Zwar hatte er ECS-Chipset,
KickStart 2.0 und 1 MB serienmäßig, war also besser als der Vorgänger. Jedoch
liefen viele Spiele nicht, weil er nicht 100%-kompatibel war. Spieledesigner
waren überrascht, die Vorserienmodelle hatten diese Probleme nicht gehabt.
Trotz allem blieb das Management bei seiner Entscheidung. Die alten A500, die
man noch im Lager hatte, wurden zu reduzierten Preisen verscherbelt. Darauf stürzten
sich die Käufer, der A500+ blieb liegen. Man hatte den gerade erholten Markt
wieder tief erschüttert.
Dem
Amiga ging es ausnahmsweise gut. Er verkaufte sich passabel, die Kunden waren
wegen prompter Lieferung recht zufrieden, die Entwickler hatten Anteil am
Geschehen, da machte das Management einen Riesenfehler. Der Amiga
500 wurde durch den Amiga 500plus ersetzt. Zwar hatte er ECS-Chipset,
KickStart 2.0 und 1 MB serienmäßig, war also besser als der Vorgänger. Jedoch
liefen viele Spiele nicht, weil er nicht 100%-kompatibel war. Spieledesigner
waren überrascht, die Vorserienmodelle hatten diese Probleme nicht gehabt.
Trotz allem blieb das Management bei seiner Entscheidung. Die alten A500, die
man noch im Lager hatte, wurden zu reduzierten Preisen verscherbelt. Darauf stürzten
sich die Käufer, der A500+ blieb liegen. Man hatte den gerade erholten Markt
wieder tief erschüttert.
Außerdem wurde wieder einmal der Leiter der Entwicklungsabteilung
ausgewechselt. Projekte wurden gestoppt, der neue Leiter kurbelte neue
Entwicklungen an, wieder ging Zeit verloren. Das neue Sonderchipset
"AA" (Advanced Amiga, eine komplett neuentwickelte Version von Jay
Miner 1985er-Chips mit mehr Farben, 32-Bit-Zugriff, usw.) war fertig, und sollte
ab April 1991 im A3000 zusammen mit einem DSP eingebaut werden. Der neue Mann
brach alles, was mit AA zu tun hatte, ab und ließ statt dessen einen A300, eine
kleine Version des A500 als C64-Nachfolger entwerfen(später als A600
verkauft).
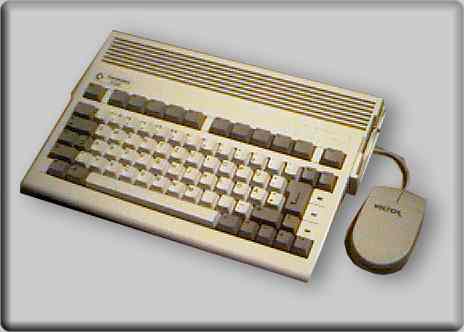 Der
A600 war ein
Flop. Von Anfang an. Bereits seine Leistungsmerkmale konnten, auch mit massivem
Werbe-Aufgebot (das es sowieso nicht gab) niemals erfolgreich sein. Das
Motherboard steckte in einem kleinen Gehäuse, die Tastatur war erheblich
schlechter als die des A500, ergonomisch ungünstig und hatte keinen
Ziffernblock. Somit konnte man in manchem Amiga-Programm nicht alle Funktionen
auslösen, weil diese Software zwischen den Zahlen im normalen und im
Zehnerblock unterscheidet. Ansonsten war es ein A500-System
mit ECS,
das aber vollständig in SMD-Bauweise gefertigt wurde. Keinerlei interne
Erweiterungen der bisherigen Amigas paßten, den externen Zorro-II-Bus hatte man
ganz eingespart, statt dessen gab es einen Einschub für PCMCIA-Karten (die in
Industrie-Notebooks für RAM-Erweiteurng, Modems oder Festplatten genutzt
wurden). Leider war diese Karte eine 16-Bit-Karte. Zwar wurde der eingesteckte
Speicher vom A600 als FastRAM bezeichnet, und konnte nur vom Prozessor
adressiert werden. Doch war der Slot ein Flaschenhals und das so gewonnene
FastRAM langsamer als das interne ChipRAM! Da tröstete es den Anwender nicht
sehr, daß er einen Festplattencontroller serienmäßig eingebaut hatte (für
2,5-Zoll-Festplatten. Diese waren damals doppelt bis dreimal so teuer wie
normale AT-Bus-Platten.) Der eingebaute Speicher ließ sich durch eine
Speicherkarte intern auf maximal 2 MB erweitern, auf dieser Karte saß auch die
auf dem Motherboard weggesparte Echtzeituhr mit Akkupufferung. Weitere Ausbaumöglichkeiten
gab es nicht. So war der A600 kein Fortschritt, obwohl er kompatibler zum
"alten" A500 als der A500+
war. Man hatte das KickStart in der Version 2.05 verwendet, in dem einige Fehler
der Version 2.04 beseitigt wurden. Und die neue WorkBench 2.1 war nichts anderes
als die alte 2.0, jedoch erstmals in verschiedenen Sprachen (alle anderen
Versionen zuvor gab es nur in Englisch). Nach 8 Jahren Amiga hatte der Markt
jedoch größere Neuerungen erwartet (mehr Farben, mehr Rechenleistung,
16-Bit-Sound, schnellere Schnittstellen, usw.)
Der
A600 war ein
Flop. Von Anfang an. Bereits seine Leistungsmerkmale konnten, auch mit massivem
Werbe-Aufgebot (das es sowieso nicht gab) niemals erfolgreich sein. Das
Motherboard steckte in einem kleinen Gehäuse, die Tastatur war erheblich
schlechter als die des A500, ergonomisch ungünstig und hatte keinen
Ziffernblock. Somit konnte man in manchem Amiga-Programm nicht alle Funktionen
auslösen, weil diese Software zwischen den Zahlen im normalen und im
Zehnerblock unterscheidet. Ansonsten war es ein A500-System
mit ECS,
das aber vollständig in SMD-Bauweise gefertigt wurde. Keinerlei interne
Erweiterungen der bisherigen Amigas paßten, den externen Zorro-II-Bus hatte man
ganz eingespart, statt dessen gab es einen Einschub für PCMCIA-Karten (die in
Industrie-Notebooks für RAM-Erweiteurng, Modems oder Festplatten genutzt
wurden). Leider war diese Karte eine 16-Bit-Karte. Zwar wurde der eingesteckte
Speicher vom A600 als FastRAM bezeichnet, und konnte nur vom Prozessor
adressiert werden. Doch war der Slot ein Flaschenhals und das so gewonnene
FastRAM langsamer als das interne ChipRAM! Da tröstete es den Anwender nicht
sehr, daß er einen Festplattencontroller serienmäßig eingebaut hatte (für
2,5-Zoll-Festplatten. Diese waren damals doppelt bis dreimal so teuer wie
normale AT-Bus-Platten.) Der eingebaute Speicher ließ sich durch eine
Speicherkarte intern auf maximal 2 MB erweitern, auf dieser Karte saß auch die
auf dem Motherboard weggesparte Echtzeituhr mit Akkupufferung. Weitere Ausbaumöglichkeiten
gab es nicht. So war der A600 kein Fortschritt, obwohl er kompatibler zum
"alten" A500 als der A500+
war. Man hatte das KickStart in der Version 2.05 verwendet, in dem einige Fehler
der Version 2.04 beseitigt wurden. Und die neue WorkBench 2.1 war nichts anderes
als die alte 2.0, jedoch erstmals in verschiedenen Sprachen (alle anderen
Versionen zuvor gab es nur in Englisch). Nach 8 Jahren Amiga hatte der Markt
jedoch größere Neuerungen erwartet (mehr Farben, mehr Rechenleistung,
16-Bit-Sound, schnellere Schnittstellen, usw.)
Fazit: Der A600 ist nichts Neues, sondern alter Wein in neuen Schläuchen. Der
Vorteil des HD-Controllers sieht sich nur Nachteilen gegenüber. Da der A500+
auch noch billiger verkauft wurde (die Entwicklungskosten des A600 mußten
hereingeholt werden), war das schnelle Ende des neuen Rechners abzusehen.
Der A600
war ein Flop. Der vom Management geplante Rechner (A2200, als Lückenfüller
zwischen A600
und A3000
geplant) wurde von allen Commodore-Tochtergesellschaften weltweit boykottiert.
Er kam deswegen über das Planungsstadium nicht hinaus. Finanziell sah es wegen
der rückläufigen Verkaufszahlen (der A500
war "rausverkauft" worden, der A500+
zwar technisch besser, aber leider nicht 100% kompatibel und der A600 sowieso
ein Flop) düster aus. Dem großen Konzern CBM drohte wieder einmal das Geld
auszugehen. Auf Druck des mittleren Managements und der Vertriebsleute holte man
"AA" (Advanced Amiga) aus der Versenkung. Die neuen Chips mit mehr
Farben, mehr Speicher und durchgehender 32-Bit-Architektur waren bereits vor
einem Jahr marktreif gewesen, 1992 wurden sie endlich in Seriengeräte verbaut.
Der A4000
als Nachfolger des A3000
kam wieder als Desktopgerät mit abgesetzter Tastatur daher, aufgrund der
Kundenwünsche spendierte man ihm sogar den beim A3000 weggesparten Einbauplatz
für ein 5,25-Laufwerk (vor allem für CD-Roms). Das Herz war ein Motorola
68040-Prozessor mit 25 MHz (auf einer Prozessorsteckkarte, so daß der Kunde ihn
einfach gegen leistungsfähigere CPUs auswechseln konnte.) Das Motherboard
entsprach modernster SMD-Technik, mit AA-Chipsatz, Zorro-III-Slots und
Festplattencontroller. Allerdings kein SCSI wie im A3000. Sondern
AT-Bus-Interface (IDE), damit die Festplatten im Einkauf billiger waren; leider
waren dies Platten damals erheblich langsamer als die noch im A3000 verwendeten
SCSI-Platten. Dafür war das HD-Floppylaufwerk
(das man im A3000 nachrüsten konnte) serienmäßig montiert. Erstmals wurden
keine proprietären Speichermodule verwendet, auf der Platine finden sich statt
dessen 5 PS/2-Steckplätze, so daß recht preiswerte RAM-Module aus der PC- bzw.
Mac-Welt eingebaut werden konnten (maximal 16 MB FastRAM und 2 MB ChipRAM). Der
AA-Chipsatz verhalf dem Rechner aber immer noch nicht zu einem Sound in
CD-Qualität (in PCs dank SoundBlaster und Macs damals bereits normal), von
einem Digitalen Sound Prozessor (wie ihn der fast zeitgleich vorgestellte Atari Falcon
vorweisen konnte). Und die höherauflösenden Grafikmodi (selbst die in
VGA-Qualität) wurden wieder interlaced (flimmernd) dargestellt. Die WorkBench
3.0 ist eigentlich nur die WorkBench 2.1 mit mehr Farben. Einzig KickStart 3.0
wurde erheblich modernisiert, um die AA-Chips zu betreiben.
Das Fazit aller Tester war damals: Endlich ein wirklich neuer Amiga. Er kam zwar
um mindestens zwei Jahre zu spät, aber Commodore fand wenigsten in Punkto
Grafik und Geschwindigkeit Anschluß an die PCs und Macs. Überholen konnte er
sie aber nicht mehr, so wie es der A1000
früher getan hatte. Commodore lief dem Markt hinterher, statt ihn anzuführen.
Der Verkaufspreis von ca. 5000 DM erschien damals angemessen, jedoch kamen recht
schnell Hunderte von Mark dazu: für eine echte True-Color-Grafikkarte oder eine
neue Prozessorkarte mit bis zu 66 MHz. So sahen ihn alle als MITTELklassegerät
und hofften auf einen hoffentlich bald kommenden, neuen HighEnd-Amiga (A5000?).
Um den Verkaufspreis zu senken, wurden die meisten verkauften A4000 nicht einmal
mit einer 68040/25-Prozessorkarte ausgestattet, sondern lediglich mit einem
68030/25 bestückt. Die schnellere 040-Karte kostete etwa 1000 DM mehr, was den
Erfolg des A4000 noch schwerer machte.
 Der
kleine Bruder, als Nachfolger des A500+
gedacht, war der technisch eigentlich identische, jedoch nur von einem Motorola
68EC020 mit 14 MHz getriebene A1200.
In einem ähnlichen Gehäuse wie der A600
(jedoch mit normaler Tastatur) war das Motherboard, eine optionale Festplatte
(wieder teure 2,5-Zoll-Platten), 2 MB RAM, ein RAM-Steckplatz für
Erweiterungskarten bis 16 MB FastRAM (wieder mit Uhr auf dieser Karte),
PCMCIA-Karteneinschub und interner Zorro-III-Bus eingebaut.
Der
kleine Bruder, als Nachfolger des A500+
gedacht, war der technisch eigentlich identische, jedoch nur von einem Motorola
68EC020 mit 14 MHz getriebene A1200.
In einem ähnlichen Gehäuse wie der A600
(jedoch mit normaler Tastatur) war das Motherboard, eine optionale Festplatte
(wieder teure 2,5-Zoll-Platten), 2 MB RAM, ein RAM-Steckplatz für
Erweiterungskarten bis 16 MB FastRAM (wieder mit Uhr auf dieser Karte),
PCMCIA-Karteneinschub und interner Zorro-III-Bus eingebaut.
Beide Systeme kamen zu spät, um noch im Weihnachtsgeschäft 1992 richtig Geld
zu verdienen. Wieder war die Nachfrage größer als das Angebot, die Kunden ob
der langen Lieferzeiten verärgert - und schlimmer: Die noch auf Lager liegenden
A600, CDTV
und A3000
wollte logischerweise auch niemand mehr haben. Statt veralteter ECS-Amigas zu
kaufen, warteten die Leute lieber auf die AA-Geräte. So konnte man kein Geld
verdienen. Die Quartalsverluste wuchsen. Erst nach etwa 6 Monaten stieg der
Verkauf des A1200 über den des A500. Die doppelte Rechenleistung setzte sich
langsam gegen die billigere Alttechnologie durch. Und trotzdem rüsteten viele
der A1200-Käufer ihr System durch schnellere Prozessorkarten auf. Meist waren
auf diesen Karten neben 68030-CPUs mit 32 MHz gleich FastRam-Sockel und
SCSI-Controller vorhanden, so daß der allmählichen Verbreitung des Mediums
CD-Rom nichts mehr im Wege stand.
 Das
CD32 stellt einen letzen verzweifelten Versuch dar, Marktanteile zurückzugewinnen.
Man hatte die Händler gefragt, was sie sich wünschten. Heraus kam ein
Videospiel auf der Basis des A1200
inklusive Singlespeed-CD-ROM mit der Möglichkeit, das Grundgerät zu einem
kompletten A1200 aufzurüsten. Als Nachfolger des glücklosen CDTV
angepriesen, stellt es einen idealen Kompromiß dar: recht preiswert in der
Anschaffung, spielt fast alle Amiga-CDs ab (auch viele CDTV-Titel), läßt sich
mit vertretbaren Kosten zu einem "richtigen" A1200 erweitern. So waren
sowohl Speieleentwickler als auch Kunden zufrieden. Leider ist Commodore im
Sommer 1993 schon extrem knapp bei Kasse. Die flüssigen Gelder reichen nur für
eine Serienproduktion von 100.000 CD32. Die Lieferanten bestanden angesicht der
hohen Schulden auf Vorauszahlung. Das Weihnachtsgeschäft wurde diesmal genau
richtig getroffen: Die Nachfrage ist enorm. Doch die 100.000 Geräte waren quasi
sofort ausverkauft, alle anderen Kunden mußten bis ins Jahr 1994 vertröstet
werden, bis eine zweite Auflage ausgeliefert werden sollte. Längst nicht alle
Leute warteten solange. Trotz eines Verkaufsschlagers rutschte CBM weiter in die
roten Zahlen.
Das
CD32 stellt einen letzen verzweifelten Versuch dar, Marktanteile zurückzugewinnen.
Man hatte die Händler gefragt, was sie sich wünschten. Heraus kam ein
Videospiel auf der Basis des A1200
inklusive Singlespeed-CD-ROM mit der Möglichkeit, das Grundgerät zu einem
kompletten A1200 aufzurüsten. Als Nachfolger des glücklosen CDTV
angepriesen, stellt es einen idealen Kompromiß dar: recht preiswert in der
Anschaffung, spielt fast alle Amiga-CDs ab (auch viele CDTV-Titel), läßt sich
mit vertretbaren Kosten zu einem "richtigen" A1200 erweitern. So waren
sowohl Speieleentwickler als auch Kunden zufrieden. Leider ist Commodore im
Sommer 1993 schon extrem knapp bei Kasse. Die flüssigen Gelder reichen nur für
eine Serienproduktion von 100.000 CD32. Die Lieferanten bestanden angesicht der
hohen Schulden auf Vorauszahlung. Das Weihnachtsgeschäft wurde diesmal genau
richtig getroffen: Die Nachfrage ist enorm. Doch die 100.000 Geräte waren quasi
sofort ausverkauft, alle anderen Kunden mußten bis ins Jahr 1994 vertröstet
werden, bis eine zweite Auflage ausgeliefert werden sollte. Längst nicht alle
Leute warteten solange. Trotz eines Verkaufsschlagers rutschte CBM weiter in die
roten Zahlen.
Technisch stellt das CD32 auch nicht das Optimum dar, das zu seiner Zeit möglich
war. Längst hatte sich Doublespeed bei den CD-Laufwerken durchgesetzt, die
68EC020-CPU war veraltet und langsam, wieder einmal neue Buchsen für Peripherie
wie Maus und Tastatur, die Mausemulation durch das Joypad recht holperig, noch
immer nur 8-Bit-Sounds (lediglich Audiofiles lassen sich direkt in 16-Bit-Qualität
direkt von der CD abspielen, alle diese Faktoren sprachen gegen das CD32. Die
Werbung mit dem Aufkleber "32-Bit-System" sollte gegen die
Konsolenkonkurrenz von Sega und Nintendo zielen, half aber auch nicht recht.
Gegen den Atari
Jaguar sah man extrem alt aus, das 3D0
bot besseren Sound und wesentlich mehr Rechenleistung, die Konsequenz all dessen
war die Tatsache, daß sich das CD32 nur an treue CBM-ler verkaufen ließ und
wohl auch ohne die CBM-Pleite keine allzugroßen Marktchanchen gehabt hätte.
Auch die Erweiterbarkeit mit MPEG-Decoder (fertige Filme ließen sich dann in
320 x 240 Pixeln bei 65000 Farben sowie 25 Bildern/s auf dem Monitor
betrachten) und SX32 (erweitert das Gerät zu einem vollwertigen A1200)
sprachen nicht so sehr für das CD32.
Seit
etwa 1984 hatte man ein Marketingproblem. Der C64
hatte sich quasi von selbst verkauft, es brauchte nur produziert zu werden, der
Markt nahm die Geräte problemlos auf. Beim Amiga war das anders. Zum einen war
er recht teuer, zum anderen war er ein Generationswechsel. Den A1000,
A2000, A3000
und A4000
konnte man im Profisegment plazieren, aber nur im recht kleinen Segment
Multimedia und Videobearbeitung. Dafür waren seine Grafik- und
Soundeigenschaften genau richtig. Leider rechte dieser Markt nie aus, um die
hohen Entwicklungskosten der Profi-Amigas hereinzuholen. Und die
"kleinen" Amigas für Zuhause (A500, A600,
A1200)
hatten recht schnell das Image einer "Spielekiste" weg, so daß
Heimanwender mit gehobeneren Ansprüchen (Textverarbeitung, Datenbank,
Tabellenkalkulation usw.) eher zu Rechnern mit besserem Softwareangebot in
diesem Bereich griffen (PC-Kompatible, Atari ST, Macintosh). Und kleine bis
mittlere Unternehmen griffen fast nie zum Amiga, sondern gleich zu Konkurrenz.
Zwar gab es auf dem Commodore-Rechner ebenfalls recht gute Programme in diesen
Sparten, aber der durchschnittliche Heimanwender hatte eben nur einen
Videomonitor, auf dem sich 80 x 25 Zeichen nur flimmernd darstellen ließen. Und
Commodore half den Software-Entwicklern nicht. Es gab weder Entwickler-Rabatte
noch Unterstützung durch CBM-Angestellte (mancher Hard- und Softwareanbieter
wechselte entnervt zum PC oder Mac.) So wurden zwar viele bahnbrechenden Spiele
zunächst auf dem Amiga veröffentlicht, aber kaum Anwendungssoftware. Der
Verkauf des A500, A600 oder A1200 lief nie so gut, wie sich das Management das
erhoffte. Commodores Marktanteile sanken (von über 60% noch 1984) auf unter 5%.
Zusätzlich
gab es immer den Konflikt zwischen Entwicklern und Management. Zwar wollen die
Hardware-Freaks immer mehr, als der Markt annehmen kann, und ein gutes
Management muß immer etwas bremsen. Aber Commodore bremste seine Entwicklercrew
so stark aus, daß viele frustiert den Job wechselten und zu Apple,
NeXT oder SUN
gingen. Der Chipsatz des Ur-Amigas war eigentlich von 1982, die Leute von der
damaligen Tochter Amiga
Inc wollten bei der Markteinführung 1985 schon an einer neuen Generation
bauen, doch man ließ sie nicht. Der A500/A2000, den man dann nach Jahren
vorstellte, war alter Wein in neuen Schläuchen. Eine neue Amigageneration (AA)
kam erst 1992, also mindestens 4 Jahre zu spät. Und AAA war zwar Monate vor dem
Ende fertig, wurde aber niemals ernsthaft vom Marketing in Erwägung gezogen.
Was Commodore vorhatte, wurde niemals verkündet, der Markt brodelte immer nur
von Gerüchten. Andere Firmen gaben bereits Jahre vor dem Verkauf eines neuen
Gerätes Details preis, um den potentiellen Käufer heiß zu machen, CBM
dementierte selbst wahre Gerüchte. So war der Grundstein für das Ende
eigentlich Tramiels
Wechsel zu Atari. Zwar überlebte Atari Commodore auch nur um zwei Jahre, aber
die Gründe dafür sind ganz anderer Art. Die Firmenleitung hatte von EDV
keine große Ahnung. Andere Hersteller vertraten ihr Produkt, weil sie von ihm
überzeugt waren, oder damit hofften, dem Anwender die Computerei leichter verständlich
zu machen. Tramiel wollte zwar auch "nur" Geld verdienen, er hatte
aber noch Visionen, die den Markt eroberten. Nach seinem Weggang lief das
Management dem Markt hinterher. Die einzige richtige Innovation, der Ur-Amiga,
mußte eingekauft werden. Und danach reagierte CBM nur noch auf den Markt.
Meistens viel zu spät, oftmals fielen sogar Entscheidungen, die dem
Kundenwunsch genau entgegenliefen. Man merkte es dem Konzern an, daß er von der
Finanzabteilung regiert wurde. Und sogar die waren im Vergleich mit anderen
Konzernen recht ungeschickt (vorsichtig formuliert...)
Im
Jahr 1993 verlor Commodore 357 Millionen US-Dollar, und der Marktanteil fiel auf
magere 1,7%! Im Juni entließ man mehr als die Hälfte der Beschäftigten. Ab
Ende 1993 konnte man keine Schuldentilgung mehr leisten und kämpfte verzweifelt
gegen den Untergang an. Am 25 April 1994 wurden fast alle verbliebenen Beschäftigten
entlassen; eigentlich entließ man alle bis auf die höheren Manager. Im
riesigen Gelände von West Chester gab es nur noch 20 Angestellte, wo früher
einmal über 1500 Lohn und Brot hatten. Am 29 April 1994 gab Commodore
International bekannt, daß man unfähig zur Schuldentilgung sei und das Geschäft
einstellen müßte. Die Liquidation dauerte Monate, weil CBM ein internationaler
Konzern mit vielen Tochtergesellschaften war. Da CBM eine Firma mit Stammsitz in
den Bahamas war, und viele Inverstoren aus den USA kamen, war das Ganze eine
verwickelte Finanzoperation, an der eine große Zahl von Anwälten gut
verdiente.
Warum
bekam gerade ein Deutscher den Zuschlag? Warum nicht ein US-Investor? Oder die
englische Tochter, die sich erheblich für die Konzernmutter einsetzte?
Bereits
kurz nach dem Konkurs tauchten Gerüchte auf, deutsche Entwickler (Phase 5,
Vesalia, Eagle, usw.) wollten ein Konsortium bilden, um den Namen Amiga zu
erwerben. Das stieß bei den Anwendern auf positive Reaktionen, denn in der
Vergangenheit hatten sich diese Firmen mit der Entwicklung von Grafikkarten,
Beschleunigerboards und guter Software mehr um den Amiga verdient gemacht, als
CBM selber. Die Konkursverwalter hatten jedoch nur ein Ziel vor Augen: Soviele
Dollars wie möglich für die Reste zu bekommen. Deswegen hatte auch eine andere
Gruppe nur wenig Chancen: Mitarbeiter der britischen
Commodore-Tochtergesellschaft wollten diese und CBM weltweit (als Personal Buy
Out) übernehmen. Doch auch sie bekamen nicht genügend Geld zusammen, um die
Schulden zu begleichen.
Der Chef der deutschen Computerhandelskette ESCOM, Manfred Schmitt, war selbst
zu Anfang seiner Karriere bei Commodore Braunschweig beschäftigt gewesen. Er
hatte sich dann selbständig gemacht und seine Kette von Computergeschäften auf
Platz 2 in der Bundesrepublik im Umsatz an IBM-kompatiblen PCs hinter VOBIS
gebracht. Er hatte noch reichlich Kontakte zu Commodore-Mitarbeitern. Als ihm
dann der Gedanke kam, die Namen Commodore und Amiga in seine Hände zu bekommen,
hatte er sehr gute Startchancen. Er beauftragte Petro Tschyschtschenko, dessen
Vertrag mit Commodore noch bis Februar 1995 lief, die Übernahme für ihn zu
managen. Er fuhr nach Amerika, um den Umfang der Rechte, Patente und
unverkauften Waren zu begutachten und mit den Resten der Mannschaft sowie
bereits Entlassenen über einen Wechsel zu ESCOM bzw. einer zu gründenden
Tochtergesellschaft zu sprechen. Alle Angesprochenen standen einer Übernahme
durch ESCOM positiv gegenüber. Dem Konkursverwalter bot man 7,5 Millionen
US-Dollar. Da es das bis dahin höchste Angebot war, stimmten diese dem Verkauf
prinzipiell zu.
Kurz darauf bot eine internationale Investmentgruppe 24 Millionen und ESCOM war
weg vom Fenster. Zwar waren die Absichten dieser Gruppe unklar, im Gegensatz zu
ESCOM, aber den Liquidatoren ging es nur ums Geld. Im März 1995 wurden die
deutschen Rechte von Commodore einzeln verkauft, weil der Konkursverwalter Geld
brauchte, um die auslaufenden Verträge zu bezahlen. ESCOM erwarb diese Rechte
und hatte wieder einen Fuß in der Tür. Man flog wieder in die USA und sprach
mit den Anwälten. Diese behaupteten, die deutschen Rechte seien ungültig,
ESCOM hätte nichts gekauft außer einem wertlosen Stück Papier. Petro ließ
sein Konzept zurück und flog recht wütend nach Hause. Zuhause angekommen, rief
ihn der Konkursverwalter an. Er hatte es sich überlegt, und man machte einen
Vertrag über den Verkauf der kompletten Rechte. Dieser Vertrag wurde den
Konkursgericht vorgelegt und dort akzeptiert. Für den April wurde die (nach
US-Konkursrecht vorgeschriebene) Versteigerung angesetzt.
Diese
Auktion wurde eine richtig spannende Geschichte. ESCOM bot 5,3 Millionen
inklusive Vertrag, den das Gericht akzeptiert hatte. DELL (eine US-Kette wie
ESCOM) bot plötzlich 10 Millionen, konnte aber kein Konzept vorlegen. Eine
weitere Kette bot ebenfalls, konnte aber die Kaution von 1 Million Dollar nicht
hinterlegen, die bei Angebotsabgabe erforderlich war. So wurde die Auktion
vertagt. Die Gläubiger sprachen am Abend mit Schmitt und Tschyschtschenko. Sie
waren ebenfalls vom Konzept überzeugt, wollten aber mehr Geld als die gebotenen
5,3 Millionen. DELL hatte schließlich erheblich mehr geboten. Die Gläubiger
boten die sofortige Vertragsunterzeichnung über den Verkauf an, wenn Schmitt 10
Millionen zahlen wolle. Ansonsten wollten sie, noch in der Nacht, den Vertrag
mit DELL unterschreiben. Schmitt sagte nur: "Dann geht doch zu DELL."
An nächsten Morgen präsentierte DELL ein Angebot über 15 Millionen Dollar
samt Vertrag. Allerdings mit der Option, 45 Tage lang die Aktiva der Firma
Commodore zu prüfen, um dann entscheiden zu können. Daraufhin sagte der
Richter, er halte vom ESCOM-Angebot mehr als von dieser windigen Sache, Schmitt
müsse aber mehr bieten, um die Gläubiger zufriedenzustellen. In der
Auktions-Mittagspause setzten sich ESCOM und die Gläubigervertetung zusammen
und einigten sich. Das verkündete der Richter anschließend. Die DELL-Vertreter
zogen beleidigt ab. Am 20 April 1995, ziemlich genau ein Jahr nach der Pleite,
wurde Commodore inklusive aller internationalen Rechte und Patente an ESCOM für
etwa 12 Millionen Dollar verkauft. Mehr war der einstige Riese CBM nicht mehr
wert.
Unter
dem Label "Commodore" wurden dann PCs verkauft, die zuvor einfach
"ESCOM PC" hießen. Nur das Typenschild war etwas anders. Später
tauchten Schreibmaschinen, Aktenvernichter, Telefone und Taschenrechner
"Made in Fernost" bei Einzelhandelsketten wie Metro oder REAL auf, die
mit dem Namen "Commodore" etwas aufgewertet werden sollte. Man hoffte,
der einstige Name sorge für Zugkraft.
 Die
Amiga-Linie sollte weitergeführt und fortentwickelt werden. Der frühere
Commodore-Manager Petro Tschyschtschenko wurde Direktor der
ESCOM-Tochtergesellschaft Amiga Technologies GmbH. Er hatte gute Beziehungen zu
dem ESCOM-Chef Manfred Schmitt gehabt (der früher bei CBM beschäftigt war).
Tschyschtschenko war, wie früher Jack Tramiel, ein Visionär. Er wollte den
Amiga vom Motorola-Prozessor hin zu einem zeitgemäßen Design mit RiSC-Prozessor (wie in Apple Macs auf der Basis des IBM/Motorola/Apple PPC 603)
und runderneuertem Betriebsystem (z. B. Speicherschutz, präemptives
Multitasking...) hinführen.
Die
Amiga-Linie sollte weitergeführt und fortentwickelt werden. Der frühere
Commodore-Manager Petro Tschyschtschenko wurde Direktor der
ESCOM-Tochtergesellschaft Amiga Technologies GmbH. Er hatte gute Beziehungen zu
dem ESCOM-Chef Manfred Schmitt gehabt (der früher bei CBM beschäftigt war).
Tschyschtschenko war, wie früher Jack Tramiel, ein Visionär. Er wollte den
Amiga vom Motorola-Prozessor hin zu einem zeitgemäßen Design mit RiSC-Prozessor (wie in Apple Macs auf der Basis des IBM/Motorola/Apple PPC 603)
und runderneuertem Betriebsystem (z. B. Speicherschutz, präemptives
Multitasking...) hinführen.
Doch zunächst wurde nur der A1200 unverändert wiederaufgelegt, einziges Zugeständnis
an den Markt war 1995 eine 170 MB-Festplatte und Software im Wert von über 1000
DM (unter anderem Grafik- Text- Tabellen- sowie Datenbank-Software und zwei
Spiele). Allerdings war es nicht exakt der "alte" A1200, sondern ein
leicht geänderter: die Floppy (keine High Density, sondern immer noch nur 800
KB!) war insbesondere bei Spielen inkompatibel und mußte für ca 20 - 50 DM von
Drittfirmen "gefixt" werden (A1200 aufmachen, Floppykabel abzehen,
Adapter drauf, Kabel wieder anstecken, Amiga zuschrauben). Bis Ende 1995
verkauft man 20.000 Geräte in Europa, trotz Werbekampagnen bei MacDonalds
reichte es nicht für mehr, die Massen wollten eben längst PCs mit Pentiums.
Die Wiedereinführung in die USA war für Anfang 1996 geplant, dort verramschte
man solange alte A600-Restbestände. Den A4000 gab es unverändert für 4500 DM.
Mit einem DD-Floppylaufwerk und überholter Prozessorleistung (Apple
hatte sich z. B. längst von 680XX-Prozessoren getrennt) ein überzogener Preis,
der den Verkauf nicht gerade ankurbelte. Ein High-End-Clone wurde von einer
Deutschen Firma vorgestellt: der Draco. Mit schnellem 68060 und optimierter
Video-Hardware wurde er schnell der Nachfolger für aufgerüstete A4000 bei den
Profis (z. B. in Fernsehstudios), den Massenmarkt konnte er wegen seines hohen
Preises nicht erreichen.
Zur CeBit 1996 stellt man ein selbstentwickeltes 4x-CD-Laufwerk vor und einen
neuen Amiga (Codename "Walker"), der ab September für etwa 1600 DM
erhältlich sein sollte. Auf der Basis eines Motorola 68030 (40 MHz Takt,
geplant war eine Turbokarte mit PPC 603 ev RiSC-Prozessor) tummeln sich in einem
staubsaugerähnlichen (kein Witz!) schwarzen Gehäuse einige wenige
neuentwickelte ICs, die sonstige Hardware stammte von Industrie-PCs (Tastatur,
Maus, Speicher, Festplatte, Floppy, Netzteil, CD-Rom, PCI-Bus sind keine
Eigenentwicklungen mehr. So hoffte man, Kosten zu sparen.) Die Amiga-Gemeinde
war nicht gerade begeistert. Zu langsam, CPU veraltet, PC-Komponenten, kein
RISC-Chip, altes Betriebssystem, usw. sorgten für einstimmige Ablehnung. Die
agilen deutschen Entwickler (Vesalia, Phase 5, ...) kündigten darauf die
Eigenentwicklung eines Amiga-Power-PC-Systems an. Der Markt war verunsichert.
Der Walker war ein Zeichen dafür, daß Amiga Technologies selbst nicht genau wußte,
was man wollte. Man blockierte sich selbst. So wollte man z. B. ein neues
Amiga-OS 3.5 herausbringen, es wurde angekündigt, um es gleich darauf wieder
fallen zu lassen. Petro Tscyschtschenko ließ es heimlich bei der neuen Firma
Haage & Partner (ohne Wissen der Amerikaner) weiterentwickeln, damit überhaupt
etwas vorwärts ging. Selbst die Präsentation der Amigas in den Escom-Filialen
war mehr als dürftig. Sofern die Mitarbeiter (die die PC-Technologie schon
oftmals nicht richtig verstanden und in Vergleichstest mit z. B. Vobis-Verkäufern
schlecht abschnitten) überhaupt einen lauffähigen Amiga im Laden
hatten, und den auch noch einschalteten, lief er in der 4-Farben Workbench
in der niedrigsten Auflösung. Vorhanden war auch nur die vorinstallierte
Software, weitere Software/Hardware suchte man im Laden vergeblich.
ESCOM und Amiga Technologies hatten das hoffnungsvolle Vertrauen der
Amiga-Gemeinde in kurzer Zeit verspielt. Lediglich agile deutsche Entwickler wie
Vesalia, Haage & Partner, Draco, Phase 5, ...) sorgten für etwas Hoffnung,
indem sie die Eigenentwicklung eines neuen Amiga-Systems auf Power-PC-Basis
(Prozessor in Apples PowerMacs) ankündigten. Die bald nach der Walker-Präsentation
erfolgte ESCOM-Pleite verhinderte die Fortentwicklung des Walker.
Diese
Schreckensmeldung taucht im Frühling 1996 in den Netzen auf. Die
Muttergesellschaft von Amiga Inc., die ESCOM
AG, hatte sich übernommen. Ausgehend von den ständig steigenden Umsätzen im
PC-Markt 1990 bis 1994 hatte man in Frankreich, England, den Niederlanden und in
Deutschland über 50 neue Filialen eröffnet. Das sorgte für große
Schuldenlast. Zusätzlich hatte man sich für das erwartete Weihnachtsgeschäft
1995 wie alle Jahre zuvor mit großen Mengen Hardware eingedeckt. Leider war das
Weihnachtsgeschäft 1995 das erste, in den die gesamte Branche Umsatzeinbrüche
hinnehmen mußte. Wie alle anderen großen Ketten (VOBIS, Atelco, Schadt, usw.)
saß man auf Bergen von Speichermodulen, Festplatten, Motherboard, Grafikkarten
usw, die man teuer eingekauft hatte. Weil der Umsatz ausblieb, senkten alle
Anbieter die Verkaufspreise. So mußte man teilweise unter Einstandspreis
verkaufen. Zusammen mit den Schulden, die die neuen Filialen verursachten, kamen
so große Verluste zusammen, daß der Hauptaktionär der ESCOM AG (RWE, der größte
Energieversorger der BRD) zusammen mit den Banken, den ihrer Meinung nach
Hauptschuldigen, den Firmengründer Manfred Schmidt, als Vorstandsvorsitzenden
absetzten und statt dessen Manfred Jost (ironischerweise einen ehemaligen Chef
von Commodore Deutschland) beriefen. Trotzdem war ESCOM kurz darauf zahlungsunfähig,
weil die Geldgeber keine weiteres Kapital nachschießen wollten. Die
Tochtergesellschaft Amiga Technologies war also von der Mutter in den Ruin
gezogen worden (das hatte Jack Tramiel 1965
vermeiden können!). Am 3. Juli 1996 stellte ESCOM einen Vergleichsantrag,
um sich mit seinen Schuldner auf Stundung zu einigen. Die Verhandlungen waren
erfolglos. Am 15. Juli beantragte man den Anschlußkonkurs, ESCOM war pleite.
Die europäischen Töchter (Österreich, Benelux, England, Frankreich) hielten
nur einige Tage länger aus, mußten dann ebenfalls schließen. Die französchischen
Filialen wurden schnell verkauft, die Service-Abteilung wurde von Schadt
aufgekauft (noch eine Kette in Deutschland). Die deutschen Filialen blieben
solange geöffnet, bis alle Lager ausverkauft waren. So mancher User konnte sich
günstige Schnäppchen sichern.
Wieder
hing die Amigagemeinde in der Schwebe. Viele Anwender, die den Wechsel zu ESCOM
noch mitgemacht hatten, und danach einen der neuen alten A1200 erworben hatten,
kehrten dem Amiga den Rücken und wechselten (meist zum PC). In den Anzeigenblättern
häuften sich billige Verkaufsangebote für A500 bis A4000 Systeme, laufende Gerüchte
verunsicherten den Markt weiter. Mal wollte VisiCorp die Amiga-Rechte aufkaufen
(um eine SetTopBox für den Empfang digitaler Fernsehkanäle daraus zu machen),
Zeitschriften wollten schon den Vertrag gesehen haben; ein anderes Mal Schadt
Computertechnik, dann machten deutsche Entwicklergruppen um Phase 5 und Eagle
Kaufangebote.
Die PC-Kette ESCOM wurde von ComTech (einer weiteren Kette) bereits 1996
aufgekauft, man nannte die Läden zunächst in ESCOM 2000 um, ab 1997 hießen
die Filialen, die nicht geschlossen wurden, ComTech. Erst am 27 März 1997
kaufte Gateway 2000, eine große amerikanische Kette (PC-Geschäfte und
PC-Versandhandel) überraschenderweise den Amiga auf. Amiga Technologies stellte
den Betrieb endgültig ein, dafür tauchte Amiga International auf. Es wurden
weiterhin die alten A1200 und A4000 Geräte verkauft, die bereits ESCOM nicht
loswurde. Auf dem Server "www.Amiga.de" standen im April 1998 immer
noch die Bündel-Angebote, die man bereits 1995 geschnürt hatte. Jedoch vergab
man Lizenzen an alle, die sie wollten. Die Lizenzen für die Amiga-Hardware
wurden vor allem an deutsche Entwickler verkauft, die bereits früher
Erweiterungen und Tower-Umbauten für die Commodore-Rechner produzierten
(Vesalia, Phase 5, Eagle). Die Rechte am Namen "Commodore" gingen an
Tulip Computers, einem niederländischen PC-Anbieter. Der ging jedoch 1998
ebenfalls pleite, so daß 1999 der Server "Commodore.Com" lediglich
eine einzige Seite mit der Einstellung des Verkaufs und dem Hinweis, daß
Commodore-Produkte ggf. nicht Jahr-2000-fest wären. Allerdings erschienen immer
wieder Geräte unter dem Label "Commodore Office Line" auf dem Markt,
allerdings waren es lediglich Billig-Importe aus China (Telefone,
Anrufbeantworter, Papiervernichter, Faxgeräte , u. ä.).
Gateway
(das 2000 wurde 1999 fallengelassen, weil man im Jahre 2001 nicht veraltet
klingen wollte) teilte Amiga International auf: In Braunschweig verblieb nur die
Verwaltung und ein Lager, in den USA entstand unter Jeff Schindler eine neue
Entwicklungsabteilung. Doch die Verlautbarungen von AI erinnerten leider an übelste
Commodore-Tage: Gerüchte tauchten auf, es wurde dementiert, gleich darauf
offiziell angekündigt und dann doch wieder dementiert (so z. B. das eigentlich
fertige OS 3.5). 18 Monate nach der Übernahme hatte AI nichts, aber auch gar
nichts auf die Beine gestellt, keinen sehnsüchtig erwarteten Rechner, kein
neues OS, nur immer noch A1200-Bundles, die man von ESCOM "geerbt"
hatte und die immer noch niemand haben wollte, weil die Technik immer mehr
veraltete. Lediglich die Lizenzvergabe klappte hervoragend, so hatte eine
amerikanische Firma das Recht, alle möglichen Dinge mit dem Logo zu schmücken,
also Tassen und T-Shirts mit dem Amiga-Logo darauf zu produzieren. Das brauchte
die Amiga-Gemeinde nun wirklich nicht. Nur weil "Powered by
Amiga"-Aufkleber zu haben waren, kaufte niemand einen Computer. Viele
ehemals treue Amiga-Anwender, denen das dasein eines Nischensystems nichts
ausmachte, und die Nachteile wie kaum neue Software und Spiele, langsame
Hardware (im Verkaufszustand), relativ hohe Preise für der Zeit angemessene
Hardware (Grafik-, Sound-, Schnittstellen-, Beschleunigerkarten müßten ja
immer von Fremdfirmen erworben werden) und Nachhinken in den Internet-Standarts
(so gibt es weder den Microsoft noch den Netscape-Browser für Amiga-OS) in Kauf
nahmen, wechselten nun doch, weil sie in Gateway keine Zukunft mehr sahen, auf
PCs und Apple
Macintoshs. Nur die ganz Standhaften erwarben eine PPC-Karte, die einen neuen
Amiga-Standart (nur nicht von AI) darstellte. Allerdings reichte für diesen
Standart eine Verkaufszahl von 15.000 Karten weltweit aus. Soviele
Computer verkaufte ALDI (die Lebensmittelkette) bei einer einzigen
PC-Verkaufs-Aktion in der BRD.
Ende 1998 raffte sich Gateway doch endlich auf. Man sagte sich, daß die Übernahme
der Amiga-Technologie viel Geld gekostet, aber noch keine Ergebnisse gebracht
hatte. So wurden die amerikanischen Entwickler angetrieben, ein neues OS und
einen neuen Rechner zu entwickeln. Gab es davor nur schnell dementeirte Gerüchte,
präsentierte man im November 1998 in Köln einen neuen Partner von Amiga
International: QNX! Diese Firma hatte ein kleines, schnelles
Multitasking-Betriebssystem für IBM-kompatible PCs programmiert (dort aber
wegen des Erfolges von Windows, Linux und der Konkurrenz von BeOS dann doch
keine Chancen gesehen), dieses sollte auf den Amiga portiert werden, um das
alte, seit 1983/85 nur immer größer und langsamer gewordene AmigaOS zu
ersetzten. Doch am 20. 1. 1999 wurde wieder alles umgeworfen; QNX! gestoppt, die
alten Entwickler um Petro Tschyschtschenko und Jeff Schindler in die zweite
Reihe geschickt und Jim Collas, der bis dato Vize bei Gateway war, als neuer Präsident
eingesetzt. Weitere Entwickler gingen, neue kamen. Das AmigaOS sollte nun wieder
von Haage & Partner fortentwickelt werden, die PPC-Plattform endlich
Standart werden.
Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Im 4 Quartal wurde Jim Collas gefeuert,
und das engültige Aus für die Hardwareentwicklung verkündet. Es stellt sich
nur die Frage, warum Gateway erst alles kaufte, lange Gerüchte und Absichtserklärungen
verbreitete und zurückzog, Entwickler einstellte und feuerte, um dann doch
alles einzustampfen. Jedenfalls wurde die alte Commodore-Politik des
ungesteuerten Chaos nahtlos fortgesetzt. Hätten ESOM und Gateway Nägel mit Köpfen
gemacht, statt Luft zu produzieren, hätte der Amiga möglicherweise überleben
können. Doch so war das Ende 1994 eigentlich definitiv, die Bemühungen hatten
nur den Effekt der "Leichenkonservierung". Harte Worte, aber m. E. der
Situation gerecht.
Alles
in allem sieht man an der Geschichte von Commodore bzw. deren Nachfolgern, was
passiert, wenn reine Geschäftemacher einen Traumcomputer-System übernehmen.
Nicht die Entwickler bestimmten die Firmenpolitik, sondern das Management
diktierte den Kurs. Wären der C64 und der Amiga nicht so faszinierende
Computer, wären ihnen die Anwender nicht Jahre über das Ende der Produktion
hin treu geblieben.
Was aus dem Amiga wird, ist leider abzusehen. Zwar gibt es immer noch Anwender,
die mit ihrem aufgerüsteten Amiga zufrieden sind. In der Videobearbeitung
spielt er immer noch eine Rolle, doch das Ende ist m. E. abzusehen. Andere
Systeme wie Mac und PC holen gewaltig auf, Pentium-III-Systeme mit Videokarten
(z. B. Fast AV-Master) sowie Digital Video mit FireWire stehen den Grafik- und
Soundfähigkeiten des Amiga in nichts nach oder sind sogar besser, teilweise
billiger erhältlich und haben eine große Verbreitung gefunden. So wechseln
immer mehr Menschen zu anderen Computern. Die Luft für den Amiga wird so immer
dünner. Leider. Mögen uns die Anwender von "NICHT-PC-HARDWARE" (2000
nur noch Apple
und SUN ,
nachdem Atari
sich 1995/97 selbst beseitigte und Acorn 1999 das Handtuch warf) noch lange
erhalten bleiben. Der Verlust wäre schmerzlich.
 Kuriosum
zum Schluß: Im September 1998 stellte die belgische Firma Web Computers einen
Rechner vor, den sie C64 nannten. Doch der Name sollte nur an den einfach zu
bedienenden Vorgänger erinnern. Technisch hat der mit dem alten C64 nichts
gemeinsam, es ist ein IBM-PC-kompatibles Gerät. Herz ist ein AMD
Mikrokontroller auf 486-Basis (66 MHz), dazu kommen 32 MB RAM, 32 MB ROM
(beinhaltet PC-DOS 7 und ein angepaßtes Windows 3.1 sowie von Lotus AmiPro
(Textverarbeitung), 1-2-3 (Tabellenkalkulation), Lotus Organizer, Netscape
Navigator und ein C64-Emulator, um den Namen zu rechtfertigen). Verbindung zum
Internet geschieht über ein eingebautes 56K-Modem, zur Tastatur gibt es noch
ein Trackpad. Als Massenspeicher gibt es nur eine 3,5-Zoll-Floppy, statt
Festplatte mußte ein 2MB-Flash-ROM herhalten. Als Preis wurden 700 DM
angepeilt. Der Verkauf lief aber äußerst schleppend, da man damals für 999 DM
NoName-PCs mit Harddisk und Pention 166 MHz nachgeworfen bekam. Anfang 2000
wurde das Gerät unter dem Label "Commodore" bei Toys'R'Us als
Internet-Zugang für den heimischen Fernseher (SetTopBox) angeboten.
Verkaufsargumente waren: Billig, sicher, Spiele ohne Ende (bezog sich auf den
C64-Emulator).
Kuriosum
zum Schluß: Im September 1998 stellte die belgische Firma Web Computers einen
Rechner vor, den sie C64 nannten. Doch der Name sollte nur an den einfach zu
bedienenden Vorgänger erinnern. Technisch hat der mit dem alten C64 nichts
gemeinsam, es ist ein IBM-PC-kompatibles Gerät. Herz ist ein AMD
Mikrokontroller auf 486-Basis (66 MHz), dazu kommen 32 MB RAM, 32 MB ROM
(beinhaltet PC-DOS 7 und ein angepaßtes Windows 3.1 sowie von Lotus AmiPro
(Textverarbeitung), 1-2-3 (Tabellenkalkulation), Lotus Organizer, Netscape
Navigator und ein C64-Emulator, um den Namen zu rechtfertigen). Verbindung zum
Internet geschieht über ein eingebautes 56K-Modem, zur Tastatur gibt es noch
ein Trackpad. Als Massenspeicher gibt es nur eine 3,5-Zoll-Floppy, statt
Festplatte mußte ein 2MB-Flash-ROM herhalten. Als Preis wurden 700 DM
angepeilt. Der Verkauf lief aber äußerst schleppend, da man damals für 999 DM
NoName-PCs mit Harddisk und Pention 166 MHz nachgeworfen bekam. Anfang 2000
wurde das Gerät unter dem Label "Commodore" bei Toys'R'Us als
Internet-Zugang für den heimischen Fernseher (SetTopBox) angeboten.
Verkaufsargumente waren: Billig, sicher, Spiele ohne Ende (bezog sich auf den
C64-Emulator).
Commodore,
CBM, Amiga, das Commodore-Logo, das Amiga-Logo, PET, VIC20, C64, SX64, C16,
C116, C128, C610, C900, SFD1001, Zorro, Walker, Denise, AGA, "AA",
"AAA", A500, A500plus, A600, A1000, A1200, A2000, A3000, A4000,
A4000T, Intuition, WorkBench, usw. sind Warenzeichen von Commodore, Amiga
International, Amiga Technologies, und Gateway. Alle Angaben sind nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht. Da es aber noch keine wissenschaftlich exakte
Darstellung der Computerhistory gibt, sind Fehler unvermeidlich und stellen
keine bewußte Verzerrung der Geschichte der genannten Firmen dar.
Quellen:
Kenny Anderson
Carl Slacker
Amiga-Magazin
Amiga Plus
Happy Computer
c't
Arnim Wolff
diverse Webpages verschiedener, meist englischer bzw. amerikanischer Autoren
Stand: Mai 2000
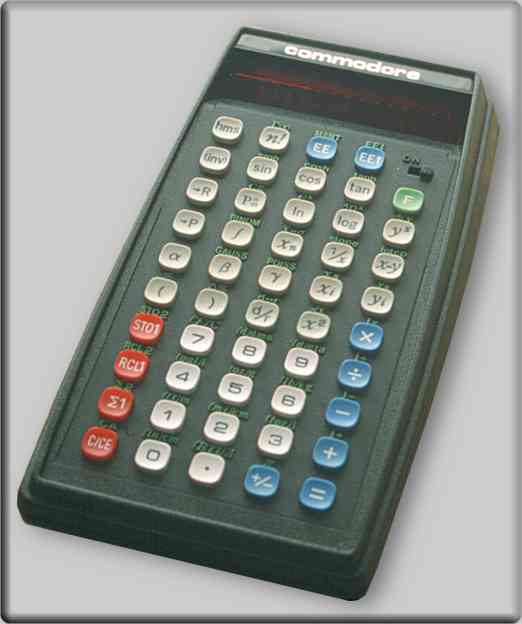 Trotz
allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen
als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den
nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen
Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den
amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern
aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß
das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr
bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969
seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das
Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem
Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst
Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern
(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer
Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als
man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die
vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa
400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.
Trotz
allem erwies sich der Markt der Rechenmaschinen
als zu hart, um Geld zu verdienen. Damals überschwemmte Japan den
nordamerikanischen Büromaschinenmarkt mit billigen mechanischen
Addiermaschinen. Ein letzter Versuch war Tramiels Reise nach Japan, um den
amerikanischen Vertrieb irgendeines Anbieters von elektronischen Tischrechnern
aus Fernost zu bekommen. Denn dem findigen Geschäftsmann war längst klar, daß
das Ende der mechanischen Ära im Büromarkt gekommen war. Nach seiner Rückkehr
bewegte er Commodore weg von den mechanischen Addierern und verkaufte ab 1969
seinen ersten elektronischen Tischrechner. Allerdings stellte Commodore das
Gerät nicht selbst her, er ließ nur das Logo aufkleben. Basierend auf einem
Bowmar LED-Display und einem Texas Instrument Chip, war er so einfach, das erst
Sir Clive Sinclair etliche Jahre später das Design vereinfachen und verkleinern
(und damit CBM und TI Konkurrenz schaffen) konnte. Zum ersten Mal seit langer
Zeit hatte CBM keine Geldsorgen mehr, der Rechner verkaufte sich schneller, als
man ihn herstellen konnte. Alle waren verrückt nach einem Ding, das nur die
vier Grundrechenarten beherrschte, weit über 100 Dollar kostete (damals etwa
400 DM) und auch noch dauernd ausverkauft war.

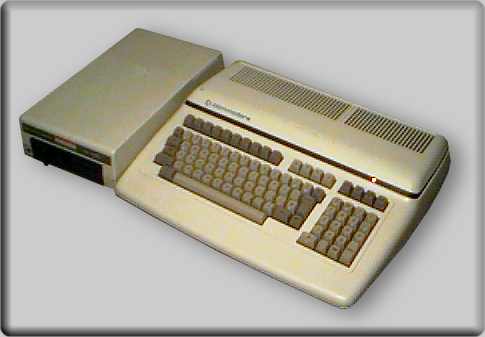
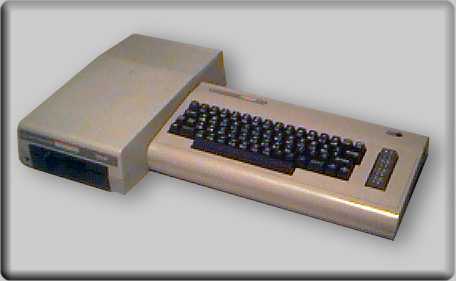

 Jack
Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte
alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was
ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem
Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein
Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng
hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft
aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne
in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von
Jack
Tramiel war für seine knochenharten Geschäftspraktiken bekannt. Er wußte
alles über seine Firma, traf fast alle wichtigen Entscheidungen und alles, was
ihm nicht paßte, wurde geändert. Wer ihn ärgerte, flog. Commodore war auf dem
Papier eine Aktiengesellschaft, aber Tramiel führte sie wie ein
Familienunternehmen. Das hatte zur Folge, daß die Managementstruktur streng
hierarchisch ausgelegt war und alles wie ein Unternehmen der Planwirtschaft
aufgebaut war. Als Tramiel (auf dem Bild der zweite von rechts) 1983 seine Söhne
in der Firmenleitung unterbringen wollte, regte sich endlich Widerstand von 
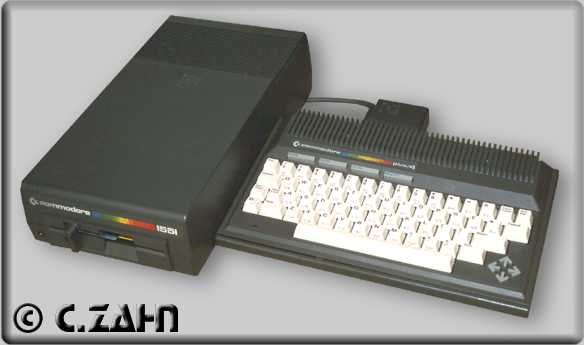

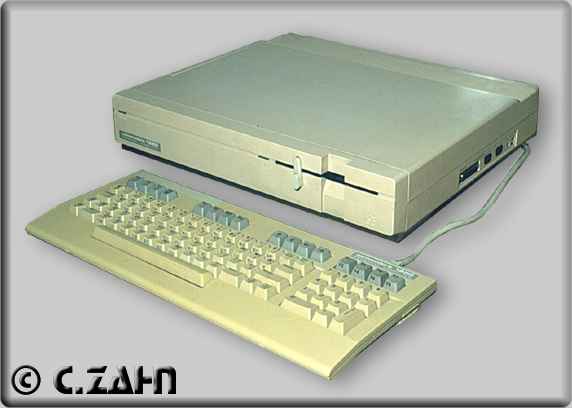
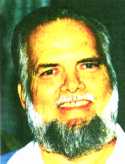 Die
Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und
Soundchips der Atari
2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer
entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von
Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich
dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)
mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser
sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.
Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma
unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem
Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.
Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der
Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten
sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man
"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären
Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen
Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's
Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen
"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -
der Name war gefunden.
Die
Geschichte des Amigas beginnt etwa 1982. Jay Miner (er hatte die Grafik- und
Soundchips der Atari
2600 Videospiele und der Atari 400/800-Computer
entworfen) war damals bei einem Chiphersteller mit der Entwicklung von
Herzschrittmacher-Bausteinen beschäftigt. Logischerweise langweilte er sich
dort. Als Larry Kaplan (ein ehemaliger Kollege Miners bei Atari)
mit dem Gedanken, eine eigene Firma zu gründen, an Miner herantrat, war dieser
sofort bereit, seinen Job aufzugeben und sich selbständig zu machen.
Interessanterweise trieb Miners Chef weitere Leute auf, die die neue Firma
unterstützen wollten: David Morse (Manager bei Tonka Toys, die damals vor allem
Blechautos bauten) und einige Geldgeber, darunter ein paar Ärzte aus Florida.
Diesie waren zu viel Geld gekommen und wollten es steuergünstig anlegen. Der
Erfolg der Apple II, Atari 400/800 und TRS80-Geräte sowie des PET ermutigten
sie, in die Firma von Miner und Co zu investieren. Die Neugründung nannte man
"Hi Toro". Ziel sollte die Neuentwicklung eines revolutionären
Videospiels sein. Leider verschreckte der seltsame Name so manchen
Stellenbewerber um die ausgeschriebenen Posten bei Hi Toro's
Entwicklungsabteilung. Der Name mußte geändert werden. Man suchte einen
"freundlichen" Namen. Auf spanisch heißt "Amiga" Freundin -
der Name war gefunden.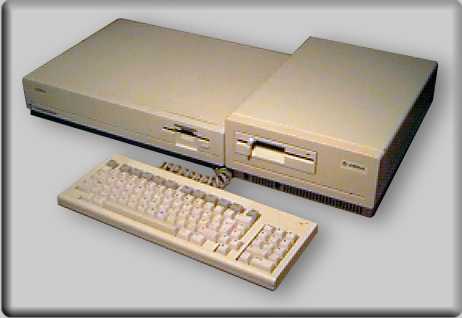

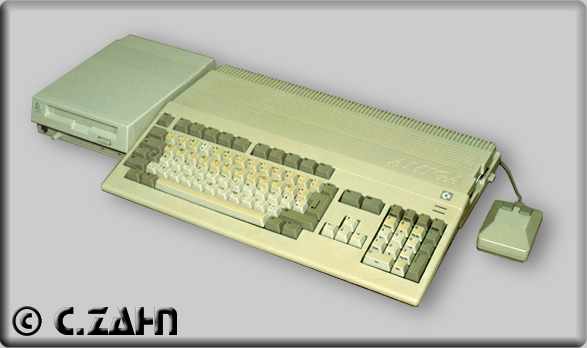
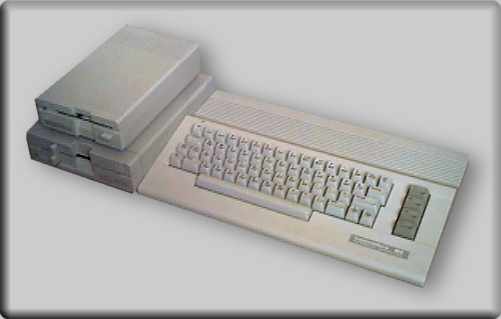
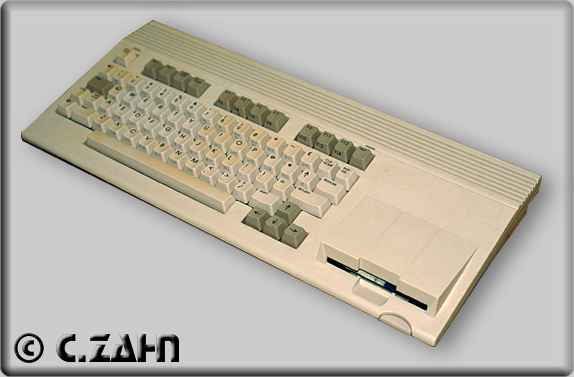
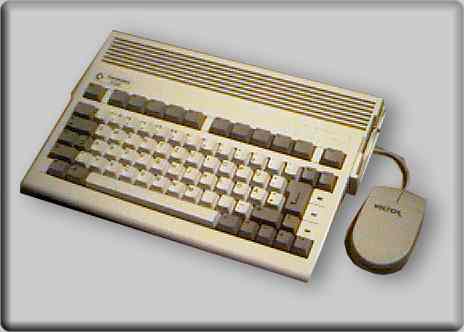


 Die
Amiga-Linie sollte weitergeführt und fortentwickelt werden. Der frühere
Commodore-Manager Petro Tschyschtschenko wurde Direktor der
ESCOM-Tochtergesellschaft Amiga Technologies GmbH. Er hatte gute Beziehungen zu
dem ESCOM-Chef Manfred Schmitt gehabt (der früher bei CBM beschäftigt war).
Tschyschtschenko war, wie früher Jack Tramiel, ein Visionär. Er wollte den
Amiga vom Motorola-Prozessor hin zu einem zeitgemäßen Design mit RiSC-Prozessor (wie in Apple Macs auf der Basis des IBM/Motorola/Apple PPC 603)
und runderneuertem Betriebsystem (z. B. Speicherschutz, präemptives
Multitasking...) hinführen.
Die
Amiga-Linie sollte weitergeführt und fortentwickelt werden. Der frühere
Commodore-Manager Petro Tschyschtschenko wurde Direktor der
ESCOM-Tochtergesellschaft Amiga Technologies GmbH. Er hatte gute Beziehungen zu
dem ESCOM-Chef Manfred Schmitt gehabt (der früher bei CBM beschäftigt war).
Tschyschtschenko war, wie früher Jack Tramiel, ein Visionär. Er wollte den
Amiga vom Motorola-Prozessor hin zu einem zeitgemäßen Design mit RiSC-Prozessor (wie in Apple Macs auf der Basis des IBM/Motorola/Apple PPC 603)
und runderneuertem Betriebsystem (z. B. Speicherschutz, präemptives
Multitasking...) hinführen. Kuriosum
zum Schluß: Im September 1998 stellte die belgische Firma Web Computers einen
Rechner vor, den sie C64 nannten. Doch der Name sollte nur an den einfach zu
bedienenden Vorgänger erinnern. Technisch hat der mit dem alten C64 nichts
gemeinsam, es ist ein IBM-PC-kompatibles Gerät. Herz ist ein AMD
Mikrokontroller auf 486-Basis (66 MHz), dazu kommen 32 MB RAM, 32 MB ROM
(beinhaltet PC-DOS 7 und ein angepaßtes Windows 3.1 sowie von Lotus AmiPro
(Textverarbeitung), 1-2-3 (Tabellenkalkulation), Lotus Organizer, Netscape
Navigator und ein C64-Emulator, um den Namen zu rechtfertigen). Verbindung zum
Internet geschieht über ein eingebautes 56K-Modem, zur Tastatur gibt es noch
ein Trackpad. Als Massenspeicher gibt es nur eine 3,5-Zoll-Floppy, statt
Festplatte mußte ein 2MB-Flash-ROM herhalten. Als Preis wurden 700 DM
angepeilt. Der Verkauf lief aber äußerst schleppend, da man damals für 999 DM
NoName-PCs mit Harddisk und Pention 166 MHz nachgeworfen bekam. Anfang 2000
wurde das Gerät unter dem Label "Commodore" bei Toys'R'Us als
Internet-Zugang für den heimischen Fernseher (SetTopBox) angeboten.
Verkaufsargumente waren: Billig, sicher, Spiele ohne Ende (bezog sich auf den
C64-Emulator).
Kuriosum
zum Schluß: Im September 1998 stellte die belgische Firma Web Computers einen
Rechner vor, den sie C64 nannten. Doch der Name sollte nur an den einfach zu
bedienenden Vorgänger erinnern. Technisch hat der mit dem alten C64 nichts
gemeinsam, es ist ein IBM-PC-kompatibles Gerät. Herz ist ein AMD
Mikrokontroller auf 486-Basis (66 MHz), dazu kommen 32 MB RAM, 32 MB ROM
(beinhaltet PC-DOS 7 und ein angepaßtes Windows 3.1 sowie von Lotus AmiPro
(Textverarbeitung), 1-2-3 (Tabellenkalkulation), Lotus Organizer, Netscape
Navigator und ein C64-Emulator, um den Namen zu rechtfertigen). Verbindung zum
Internet geschieht über ein eingebautes 56K-Modem, zur Tastatur gibt es noch
ein Trackpad. Als Massenspeicher gibt es nur eine 3,5-Zoll-Floppy, statt
Festplatte mußte ein 2MB-Flash-ROM herhalten. Als Preis wurden 700 DM
angepeilt. Der Verkauf lief aber äußerst schleppend, da man damals für 999 DM
NoName-PCs mit Harddisk und Pention 166 MHz nachgeworfen bekam. Anfang 2000
wurde das Gerät unter dem Label "Commodore" bei Toys'R'Us als
Internet-Zugang für den heimischen Fernseher (SetTopBox) angeboten.
Verkaufsargumente waren: Billig, sicher, Spiele ohne Ende (bezog sich auf den
C64-Emulator).